Geschichten
Inhalt
- Bereitschaftsdienst in Tansania
- Erotik in der Fremde
- Frauenärztin in Nicaragua

Bereitschaftsdienst in Tansania
Helmut Jäger, aus Kontextwechsel, DÜ 1998 (pdf)
Seit drei Monaten “porini kabisa” (mitten im Busch). Tansania – Touristen eilen in die Serengeti. Hierher kommen sie nie. Außer hügeliger Landschaft und freundlichen Menschen gibt es nichts zu sehen. Kleine Mais- und Kasawafelder zwischen riesigen Baobab-bäumen und verwilderten Buschwäldern. Eingestreut eine Ansammlung strohgedeckter Lehmhäuser umgeben von Cashewnuß-, Mango- und Papayabäumen. Um die verstreuten Hütten sauber gefegte, sandige Höfe, auf denen Frauen hockend kochen. Andere stampfen Hirse. Nackte Kleinkinder krabbeln zwischen Hühner und hindern dürre Hunde am Mittagsschlaf.
Die Regenzeit bleibt hier selten aus. Wenn das Vorratssystem funktionieren würde, dürfte eigentlich niemand hungern. Tansanische Ärzte wollen hier trotzdem nicht abgemalt sein. Es bleibt ihnen zu wenig zum Leben. Das Gehalt reicht gerade für den Sprit für’s Moped, das Radio und die Schuluniform der Kleinen. Für die Nahrungsmittelversorgung von Staatsangestellten ist die bäuerliche Großfamilien zuständig, und die ist bei Ärzten im Busch meist tausende von Kilometern weit weg.
In dieser Not akzeptiert man unerfahrene Mediziner aus dem Norden auf der Suche nach Abenteuer und sich selbst. Zwei Jahre Geburtshilfe und Chirurgie in Deutschland sind nicht viel, fast nichts, von der Sprach- und Kulturunkenntnis ganz zu schweigen.
Samstag:
Bin ziemlich müde und ausgelaugt vom Operieren. Abszeßspaltungen, Fehlgeburten, Leistenbrüche. Pindi’s üppiges Abendessen mit “Ugali” (Polenta), scharfen Bohnen und dem Bein einer meiner Hühner liegt mir schwer im Magen. Er wird als betagter Koch ehrfürchtig “Papa” genannt, zumal er in jungen Jahren sogar in der Hauptstadt gearbeitet haben soll.
Brot für’s Frühstück knete ich selbst mit Hefe aus mütterlichen Care-Paketen. Diesmal ist es auf dem Holzkohlenofen angebrannt und hat deshalb ein wenig Geschmack. Habe gerade noch mit Kasongo, einem Hilfspfleger, fünfzig Liter Wasser geholt. Morgen fahre ich zur Handelsorganisation, wo es wieder Mehl geben soll.
Mein Leben bekommt einen Rhythmus. Die Umgebung wird vertraut. Die Leute gewöhnen sich an die einzige weiße Nase weit und breit. Auf der letzten Nachbarschaftsversammlung wurde beschlossen, mir ein großes Feld zu überlassen, damit ich Mais und Gemüse für mich selbst anbauen kann.
Sonntag:
Wieder ein Dienstwochenende, das mich an den Ort fesselt. Ich warte vergeblich auf irgendjemanden, der reinschaut. An dem flachen, wellblechgedeckten Haus führt ein Trampelpfad zum Krankenhaus vorbei. Vorbeiziehende Mütter, die mit bunten Tüchern ihre Krabbelkinder auf den Rücken geschnallt haben, winken mir zu. Ich schaue fasziniert ihren sanften, gleitenden Bewegungen hinterher. Eine ausgesprochen hübsche Frau balanciert ohne erkennbare Anstrengung einen Tonkrug auf dem Kopf. Sie kommt etwas aus dem Rhythmus, als ich sie anlache. Es schwappen ein paar Tropfen Wasser auf ihre Schulter. Sie lächelt zurück und geht weiter.
Alte Männer, die sich endlos begrüßen, schauen herüber und nicken anerkennend, als sie sehen, daß ich versuche, Papayasetzlinge zu pflanzen. Mit unglaublichen Gekichere rennen kleine Quälgeister um mich herum, weil so ein Weißer doch ziemlich aufregend zu sein scheint.
Wir haben heute unseren Chef verabschiedet. Jetzt sind wir nur noch zwei Ärzte in einem Distrikt mit etwa hunderttausend Einwohnern. Beide gleich unerfahren.
Nichts los, viel gelesen, an einer Schachaufgabe gebastelt. War im “Club” tanzen, wo indische Händler, Soldaten und andere, die ein paar Kröten haben, mit Frauen flirten, die vielleicht zu haben sind. Mich hat niemand vom Hocker gerissen, obwohl ich schon ziemlich lange alleine schlafe. Bin aber wohlig müde. Die Leichtigkeit erotischer Hüftbewegungen, warmes Bier, der übersteuerte Discosound und fröhliches Witzeln über Refrain des Schlagers “Nakufa, je?” (“Sterbe ich?”) klingen angenehm in mir nach.
Montag:
Medikamenten – Beschaffungstour mit dem baufälligen Izuzu. Hitze, Staub, Dreckpiste mit Wellblechrillen. Abgesehen von den unermüdlichen Witzen von Matatizo dem Fahrer nichts Bemerkenswertes.
Es scheint niemanden zu nerven, mir jedesmal die Pointen umständlich erklären zu müssen, bis ich, wie in der Geschichte über einen unpopulären Politiker, die Zweideutigkeit “amelala Nambwa” (“Er schlief im Dorf Nambwa”) und “amelala nambwa” (“Er schlief mit einem Hund”) endlich begriffen habe.
Der staatliche Medikamentenstore hat fast nur leere Regale zu bieten. Missionsstationen abgeklappert und ein paar Mullbinden, Ärztemuster, Reis und Fleisch ergattert. Kommen müde, verschwitzt, eingesaut und zerschlagen gerade rechtzeitig zur rasant hereinbrechenden Dunkelheit an. Papa Pindi, nett wie er ist, hat gewartet, um mir Ugali und Bohnen aufzuwärmen. Ich trotte vorm „Duschen“ mit dem Wassereimer noch mal rüber ins Hospital um besser schlafen zu können.
Es sind nur ein paar hundert Meter zu den weit auseinanderstehenden Bungalows, die durch wellblechüberdachte Gänge miteinander verbunden sind. An der Tür der offenen Krankensäale, in denen dreißig tuberkulöse Männer auf Bettgestellen teils mit, teils ohne Matratzen dösen, hocken zwei “Bao”-Profis im Schein von Ölfunzeln auf Strohmatten bei einem abgegriffenen Holzstück mit zweiunddreißig Mulden. Doppelt so viele Kugeln klackern in faszinierender Geschwindigkeit über das Brett. Eine Gruppe von Mitpatienten kommentiert sachverständig und feuert an. Einer hat seine Infusionsflasche mitgebracht, ein anderer streckt sein nicht mehr ganz sauberes, eingegipstes Bein weit von sich, ein Dritter muß sich nach einem heftigen Hustenanfall weiter ab im Dunkeln erleichtern. An der offenen, aber überdachten Kochstelle bruzzeln alte Frauen etwas über einem flackernden Feuer für ihre kranken Verwandten und schwätzen lachend über irgendetwas Lustiges. Am Himmel türmen sich seit Tagen schwarze Wattegebilde, die den Mond am Ausleuchten hindern und mich blind über ein vergessenes Bündel mit Kochgeschirr stolpern lassen. Der erlösende Regen ist abzusehen und wird den roten Staub zwischen den Häusern bald in zähen Morast verwandeln.
„Wie schön, daß du endlich da bist!“, flötet unheilschwanger unsere füllige Hebamme mit den Antennenhaaren: „Da liegt unser Notfall und wartet auf Dich.“ Ein etwa 18-jähriges, abgemagertes Mädchen mit Wehen seit drei Tagen. Viel zu klein für dieses riesige Kind im Bauch, Schräglage, keine Kraft mehr, anämisch, fertig. Niemand ist eingefallen, das OP-Team zu alarmieren oder Blut zu beschaffen. Die halbe Großfamilie scheint mitgekommen zu sein und ist sicherlich über das Eintreffen des weißen Doktors erleichtert. Natürlich sind sie mit einer Operation einverstanden.
Jod ist noch da, Äther ist aus. Bleiben noch wenige Kisten Lokalanästhesie. Der OP – Tisch hat noch Flecken von der letzten Abszeßeröffnung, die auch beim Putzen nicht weggehen, wie mir Mtumba, der Pfleger versichert. Die grünen OP – tücher riechen fade und muffig, es trocknet halt nichts bei der feuchten Hitze. Beim Öffnen der Bauchdecke fließt mir ebensogrüne Brühe entgegen, die Gebärmutter ist angerissen, das Kind völlig verklemmt und läßt sich nur mit Mühen schlaff und blau herauszerren. Ich versuch erstmal dieses Würmchen zum Leben zu bringen und schaffe es schließlich, ihm ein leichtes Wimmern zu entlocken.
Der Anästhesiepfleger stellt lakonisch fest, der Blutdruck bei der Frau falle ab, den Puls könne er aber nicht finden, bluten würde sie aber nicht besonders. Bevor er eine neue Infusion anhängt, hört ihre Atmung auf. Ich stürze hin, Mund-zu-Mund-Beatmung, Herzmassage, während vergeblich der Tubus zum Intubieren gesucht wird. Zu spät, tot. Ich suche trotzdem weiter nach Herztönen und hoffe, in die starren Augen würde doch noch etwas Leben zurückkommen. Das Lallen des inzwischen rosigen Menschlein reißt mich von dem starren Körper über den der OP-Pfleger bereits ein grau-braunes Tuch zieht. Immerhin das Kind lebt.
Die inzwischen hinzugekommene Nachtschwester meint jedoch lakonisch, es habe ohne Mutter(-milch) sowieso keine Chance. Die Mutter des Mädchens schreit, die Verwandten tuscheln, ein alter Mann schaut mich verachtend an. Ich schiebe mich durch die Menge und wanke nach Hause.
Unter dem Moskitonetz finde ich keine bequeme Lage, höre auf das Surren der Moskitos und starre in die Dunkelheit. Durch die offenen Fenster habe ich die Umrisse des Krankenhauses gut im Blick und sehe nach ein paar Minuten, oder Stunden (?), die Taschenlampe auf mich zuflackern. „Daktari! Sorry , da ist ein kleines Problem in der Chirurgie“. Eingeklemmter Leistenbruch. Die vom OP sind leider alle weg. Bis der Nachtwächter und unser Fahrer sie zusammengetrommelt haben, vergehen wieder zwei Stunden, in denen ich mich über Kopfhörer mit Jazz zudröhne, schließlich operiere, und irgendwann traumlos wegpenne.
Dienstag:
Onya holt mich erbarmungslos um sechs Uhr zum Laufen ab. Um den Fußballplatz, vorbei an den um diese Uhrzeit noch verrammelten Inder – Läden, den Bruchbuden – Hotel und der Cashew-nußfabrik. Zurück durch die Maisfelder. Ein paar Bäuerinnen schauen uns nach, als seien wir bescheuert. Papa Pindi hat Frühstück gemacht. Nach einem guten Eimer Wasser fühle ich mich ziemlich fit.
In der Maternity warten sie wieder auf mich. Die nächste Kaiserschnittkandidatin, Querlage, Geburtsstillstand seit zwei Tagen. Diesmal probiere ich’s in Spinalanästhesie und bin in Schweiß gebadet, als gerade dann der Strom für die OP – Lampe ausfällt, als ich die Nadel zum Rückenmarkskanal vorschieben will. Immerhin sind die regelmäßigen Stromausfälle tagsüber leichter zu ertragen als nachts, wenn die Taschenlampe langsam immer dunkler wird.
Die Frau sitzt für die Prozedur mit gleichmütiger Geduld. Ein unfaßbarer Kraftaufwand bei der extremen Blutarmut und der seit einigen Tagen andauernden Geburt.
Wie ein Wunder geht diesmal alles glatt. Auch bei der anschließenden Frau, der ein Wunderheiler zu Hause mit einem Küchenmesser den Beckenknorpel über der Harnröhre durchtrennt hatte, um ein Kind (lebend!) herauszubekommen. Es sieht so aus, als würde sie überleben.
Anschließend Visite. Die Pfleger und Schwestern haben selbstsicher alles im Griff. Die meisten Patienten schaffen es trotz (?) der mehr oder weniger regelmäßig verteilten und oft zu hoch oder zu niedrig dosierten Medikamente gesund zu werden.
Im Gefängnis nachmittags sieht es dagegen wie üblich übel aus. Das Wasser ist eine Dreckbrühe. Abgemessen ist es nur für den Trinkbedarf. 45 Leute schlafen zusammengepfercht in einer Zelle auf dem Steinfußboden, einmal am Tag gibt es einen kalorienarmen und vitaminlosen Fraß ohne Protein und Fett. Alle vierhundert Insassen sind krank, unterernährt, aber die Gefängnisleitung hält sie offensichtlich für arbeitsfähig. Die Wärter sind nicht unmenschlich, aber schlecht bezahlt. Woher sollte ihr Engagement für die eingelochten armen Hunde kommen?
Vierzig von ihnen kann ich untersuchen, weil Magersucht, Tuberkulose, Immunschwäche, Hautkrankheiten, Abszesse und andere Infektionen am gefährlichsten aussahen. Ich muß mit dem Bürgermeister reden. Solange nicht wieder die Hirnhautentzündung vom Knast ausgeht, werde ich wohl wenig bewirken.
Ich treffe ihn wenig später an der Landepiste, um unseren Parlamentsabgeordneten zu begrüßen. Eigentlich will ich nicht hin, sehe aber auf dem Rückweg vom Markt, wo es geräuchertes Elefantenfleisch gab, die “Fokker Friendship” landen und bin neugierig, ob mein Elektroherd dabei ist. Der nützt mir zwar zur Zeit nichts, da meine Stromleitung keinen Saft hat, aber man weiß ja nie, wann sich das mal ändert.
Der Abgeordnete wird natürlich gleich dem einzigen “Mzungu” im Kaff vorgestellt. “Mzungu” kommt von dem Verb “kuzunguka” (“herumirren”) und kennzeichnet für die hier Lebenden den wesentlichen Charakterzug unserer Rasse.
Voll im Wahlkampffieber verspricht der Abgeordnete bereits an der Landepiste ungefragt alle Probleme des Distriktes lösen zu wollen und lädt mich für demnächst zum Kaffeeplausch, um etwaige „kleine Schwierigkeiten“ im Gesundheitsbereich zu besprechen.
Auf der Fahrt ins Städtchen ist schon die Auswirkung seiner Ankunft sichtbar: In dem Viertel, in dem sein Haus steht, wird der Strom angeschaltet. Vielleicht wird es bis zu seinem Abflug sogar Wasser, Reis und Bier geben.
Grundwasser gibt es außerhalb der Wasserleitung in Hülle und Fülle. Alles grünt während der Regenzeit. Im Umkreis finden sich zahlreiche Wasserlöcher mit Würmern und anderen Bewohnern, an denen die Frauen beim gemeinsamen Schwatz die Wäsche waschen, die Kleinen baden und anschließend Trinkwasser auf dem Kopf nach Hause balancieren. Wenn kein Diesel verfügbar ist, laufen die Grundwasserpumpen nicht, und die verseuchten Löcher bleiben die einzige Wasserquelle. Wenn die Pumpen nicht laufen können, werden sie nicht gewartet, und wenn der Diesel dann eintrifft, funktionieren sie wiederum nicht, weil sie inzwischen verrostet sind.
Mittwoch:
Nichts besonderes. Krankenhaus – Routine. Auf meine gereizte Frage, warum man im OP nicht aufräumen könne, wenn nicht viel zu tun sei, antwortet die Schwester verständnisvoll, Europäer hätten öfter Schwierigkeiten mit dem hiesigen Klima und Tee mit Zucker sei sehr hilfreich bei depressiven Gemütsschwankungen.
Ich werde bei dem phantastischen Kochkünsten von Pindi noch fett werden, zumal ich offensichtlich aus Frust mehr esse als üblich.
Donnerstag:
Tagsüber alles ruhig. Gutes Abendessen bei Dodoma-Wein und Petroleumfunzel. Diskussion mit Onya über Liebe und Erotik in Afrika und Europa.
Wieder die flackernde Taschenlampe. Diesmal war es ein fünfzigjähriger Mann, ziemlich abgearbeitet und ausgemergelt. Er wird von seiner Großfamilie angeschleppt. Heftigste Bauchschmerzen, Atmung und Puls schnell und Blutdruck flach. Der Schmerz kommt von der rechten Niere und zieht in den Oberschenkel. Leistenhernien hat er auch, aber die sind frei, ohne eingeklemmte Darmschlingen.
Labor und Röntgen sind nachts nicht möglich. Ich denke mir, es wird wohl ein Darmstillstand oder ein Muskelabszeß sein, nicht selten bei allgemeiner Abwehrschwäche. Ich alarmiere den OP und den Dieselgenerator, der tatsächlich ratternd startet. Zur Narkose nehme ich diesmal ein Kurznarkosemittel als Infusion, da ich das ohne Anästhesiepfleger, der nicht auffindbar ist, selber steuern kann.
Der Darm ist gestaut, aber ein Verschluß ist nicht erkennbar. Keine Entzündung. Ich taste von innen und außen den Rückenmuskel ab, der sich verdickt anfühlt. Inzision, aber ein Muskelabszess ist es auch nicht. Ich taste den Darm ab, nichts. Blinddarm jungfräulich. Mit dem ganzen Arm komme ich an den Magen, nichts. Dann die Leber und schließlich hab ich’s. Eine apfelsinengroße Steingallenblase, die sich mehrfach um sich selbst gedreht hat. Ich schneide den Bauch bis zum Brustbein auf und komme trotzdem nicht gut dran. Da fällt der Strom aus.
Später stellt sich heraus, das der Fahrer etwas Diesel aus dem Generatorschuppen abzweigen mußte, sonst wäre der Izuzu nicht mehr gerollt.
Es dauert etwas bis der OP-Pfleger die Kerosinlampe anschmeißt, und ich habe Zeit in der absoluten Finsternis die Gallenblase zurückzudrehen. Trotz zusätzlicher Taschenlampe, klemme ich relativ blind den Gallenblasenausgang ab, hole das Ding raus, bete, daß ich den Gallengang zwischen Leber und Darm heil gelassen habe, und versuche den Bauch zu nähen, was sich bei der oberflächlichen Narkose und dem sich wehrenden Patienten als ziemlich schwierig erweist.
Freitag:
Glück gehabt, der Mann lebt und es geht im verhältnismäßig gut.
Wunderschöner Tag. Im Garten gebuddelt und mit Onya bis in die Nacht “Bao” gespielt.
Samstag:
Ich fühl mich krank und elend.
Makota, mein Kollege, hat Bereitschaftsdienst. Um 8 Uhr gehe ich über die Geburtshilfe und sehe eine Frau, eher ein Mädchen mit Wehen seit 14 Stunden. Erste Schwangerschaft, kleines Becken, Normallage, Muttermund fast vollständig eröffnet, aber kein Kontakt zum Köpfchen. Sie sollen eine Infusion anhängen und sicherheitshalber schon mal alles für einen Kaiserschnitt wegen Mißverhältnis vorbereiten. Die Frau fühlt sich sicher und gut aufgehoben, die Verwandten werden aufgeklärt und sind mit allem einverstanden.
Um 10 Uhr komme ich wieder vorbei. Keine Veränderung. Die dürre, aber resolute Hebamme meint, das Kind käme bestimmt doch noch normal. Ich gebe ihrer Erfahrung eine Chance, außerdem hab ich viel zu tun.
14 Uhr, absolut kein Fortschritt, dafür hat die Frau immer noch keine Infusion, aber von der etwas dröseligen Kreissaalhelferin Apfelsinen gegen den Durst zu essen bekommen. Der Zustand ist noch gut. Also trotz Apfelsinen sofort Kaiserschnitt, das heißt hier in frühestens einer Stunde. Ich organisiere den OP, treffe Makota, der heute tagsüber eigentlich für den OP zuständig ist, und sage ihm, er brauche nicht zu operieren, wenn er keine Zeit habe. Er solle aber bitte das Kind annehmen und die Narkose überwachen. Kein Problem! Die Frau wird reingebracht, Mtimbuka der nur angelernte, aber zuverlässigste OP-Pfleger wird assistieren, Strom aus dem Generator scheint zu kommen, Lulambo, ein Medical Assistant (netter Kerl, lustig, aber unfähig, weil ihm jegliches Grundwissen zu fehlen scheint) wird die Narkose übernehmen. Die kindlichen Herztöne sind nicht besonders gut und ich lasse etwas spritzen, um den Blutdruck zu steigern. Der Blutdruck der Frau sei jetzt ganz OK meint Lulambo. Ich traue ihm nicht und entschließe mich zur Spinalanästhesie, da er dabei eigentlich nur den Kreislauf überwachen muß.
Die Frau wird auf die Seite gelegt und ich finde den Rückenmarkskanal schnell und problemlos an der richtigen Stelle. Dann gehe ich zum chirurgischen Waschen und wundere mich, wo mein Kollege bleibt. Ich schicke ihn holen und erfahre, er sei zu irgendeiner Sitzung im Bürgermeisteramt gefahren. Also versuche ich vom Waschbecken aus einen zusätzlichen Medical Assistant finden zu lassen, gebe alle möglichen Anweisungen, was für die Säuglingswiederbelebung vorbereitet werden soll, weil es nie automatisch klappt.
“Wie geht’s denn der Frau so?“ – “Alles klar!“. Raus aus dem Waschraum in den grau-grünen, etwas muffig riechenden OP-Klamotten. Ich sehe die Frau auf dem Rücken liegen, was sie nicht sollte, da dann die Gebärmutter mit Kind auf die Hauptschlagader drückt. Mtimbuka reicht mir die Jodschale zum Desinfizieren und Lulambo fühlt den Puls. Ich schau die Frau an, die eigentlich wach sein müßte. Sie sagt nichts, starrt reglos an die Decke und schnappt nach Luft. „Dreht sie doch verdammt noch mal auf die Seite!“ Alle starren mich an, als hätte mich der Tropenkoller gepackt. Vielleicht habe ich auch vor Schreck alles Suaheli vergessen. Ich drehe die Frau auf ihre linke Seite, schreie alle möglichen mehr oder weniger dringenden Befehle, taste nach dem Herz, was ich noch zu fühlen glaube, während Lulambo geistesabwesend versucht, das Sauerstoffbeatmungsgerät zu reparieren, und erklärt, die Sauerstoffflasche müsse wohl gegen eine neue ausgetauscht werden. Ich massiere das Herz und mache eine halbe Stunde lang alles, was mir zu Notfallmedizin einfällt. Schließlich hört das Herz ganz auf. Zitternd gehe ich zu den Verwandten, die es nicht fassen können, schließlich sollte ihre Tochter doch von einem Weißen operiert werden, und kann der es nicht am besten? Ich stolpere in OP-Zeug nach Hause, sage Fabian, er solle abhauen, und kippe sein Essen weg.
Ich bin nicht schuld, weil Makota nicht da war, weil der Medical Assistent ein Idiot ist und es in diesem Katastrophen-OP doch gar nicht anders kommen kann. Dennoch war ich es, der das Narkoserisiko unterschätzt hat, der vergessen hat zu sagen, die Frau müsse unbedingt auf der Seite liegen bleiben und man müsse regelmäßig den Blutdruck messen. Ich hab die schlechtausgebildeten Pfleger überschätzt und die Frau in den kritischen ersten zehn Minuten nicht selbst überwacht. Ich hätte sie früher operieren sollen. Ich hätte das OP-Team besser ausbilden sollen. Ich hatte die alleinige Verantwortung. Durch mich ist sie zu Tode gekommen.
Montag:
Mir ist immer noch zum Kotzen, seit zwei Tagen irre ich herum wie ein Schlafwandler. Fahre mit dem Moped bei einem polnischen Missionar vorbei, zu dessen Welt ich keinen Bezug habe, und rede ihn voll. Er erträgt es mit Fassung und spendiert reichlich selbstgebrauten Alkohol. Ich will und kann hier nicht arbeiten. Sollen sie doch lieber ohne meine Mithilfe sterben. Ich werde abhauen.
Dienstag:
Onya hat mich zum Abendessen abgeholt. Im Hof vor seinem wellblechgedeckten Lehmhaus hocken wir mit einigen Nachbarn in der wolkenlosen, sternenklaren Nacht. Zwei qualmende Petroleumfunzeln verbreiten ein diffuses Licht ohne den Blick auf das Kreuz des Südens zu stören. Wir brechen mit den Händen kleine Brocken aus dem fußballgroßen Ugaliberg, formen daraus kleine Mulden und langen in den Bohnennapf oder die Schüssel mit der Hühnchensauce. Ein Nachbar hat frisch gezapften “Tembo” (Palmwein) mitgebracht. Jemand erzählt etwas über die kommende Ernte, die diesmal gut werden solle. So gut, daß den geplanten Initiationsfeiern für die erwachsen werdenden Kinder nichts mehr im Wege steht. Dann wieder hört man nur das Kauen, das Zirpern der Grillen, den Wind in den Palmstauden und das Hantieren des zwöfjährigen Mädchens am glimmenden offenen Herd. Ein anderer berichtet von dem Unfall vor zwei Tagen auf der Sandpiste nahe der Provinzhauptstadt, als ein mit Mais und Landarbeitern überladener Kleintransporter in Schleudern kam. Einige Tote und Verletzte, zum Glück niemand aus unserem Dorf. Man sollte die Piste künftig besser in Schuß halten und das Transportproblem in den nächsten Tagen beim Abgeordneten ansprechen. Onya fragt, ob ich bei meinem Feld Hilfe brauche. Ich hab noch nicht einmal eine Hacke. Er wird sie mir leihen. Auch die anderen wollen helfen. Modesta, Onyas Frau, strahlt als ich ihr versichere, ihr Hühnchen sei noch besser als das von Pindi. Das wäre doch klar, lächelt sie, Männer hätten dafür nicht das richtige Händchen. Ich fühle mich langsam wohlig, geborgen. Ich werde doch noch etwas bleiben. Es wird eine lange Nacht. ….
Erotik in der Fremde
Auszüge aus Trainingsmaterial des DED, 1998:
„Interkultureller Umgang mit Sexualität“.
Schilderungen von Sexualität in einer zunächst fremden Kultur sind sehr subjektiv und emotional gefärbt. Der Beobachter gibt sich indirekt selbst als Person zu erkennen, mit seinen eigenen Widersprüchen, Wünschen und Frustrationen, auch wenn er direkt nur über andere schreibt.
Ruanda
„…Die erste Erfahrung, die ich nach meiner Ankunft in Ruanda machte, war die der hautnahen körperlichen Reizüberflutung, eine Stimulierung der Sinnesorgane, wie es für uns Mitteleuropäer, die wir unsere Umwelt mehr über den Kopf aufnehmen, recht ungewohnt ist. Da drängen sich die Menschen aufeinander, fassen sich viel und lange an, halten ungezwungen Händchen, umarmen sich auf offener Straße. Eine Sinnlichkeit erfüllt die Luft und das Straßenbild, wie man sie in der kühlen, strengsterilen Sachlichkeit der Betonstädte Mitteleuropas vergeblich sucht und höchstens noch im mediterranen Raum findet. Besonders in einem extrem überbevölkerten Land wie Ruanda, wo die Menschen gewohnt sind, auf engstem Raum miteinander zu leben, wird man sich schnell der eigenen Körperlichkeit bewußt, der Verkrampfungen, aber auch der Bedürfnisse. In Unkenntnis der herrschenden Rituale und Verhaltensmuster wird überschnell eine oft nicht vorhandene Nähe zur Sexualität in verschiedene Körperausdrücke hineininterpretiert: in Ruanda beispielsweise sind Begrüßungsformeln streng ritualisiert, Männer gehen Hand in Hand, ohne homosexuell zu sein, dagegen ist der zwischengeschlechtliche Kontakt wie Küssen in der Offentlichkeit nicht anzutreffen.
Gepaart mit dem Reiz des Neuen und dem Drang nach Kontakten findet sich der Neuankömmling schnell in der glitzernden Disco-Halbwelt aller afrikanischen Großstädte wieder, wo eine Unzahl von Prostituierten in europäischer Verpackung auf den ,,umuzungu“ wartet, um ihm gegen hartes Entgelt seinen sexuellen Appetit zu stillen. Wer nach Zärtlichkeit und Zuneigung sucht, um seiner Hügeleinsamkeit zu entgehen, ist hier sicherlich am falschen Ort. Der Markt der sogenannten freien Liebe gehorcht Marktgesetzen, und da der Europäer die bessere Stellung und die dickere Brieftasche besitzt, genießt er absoluten Vorrang…..Es finden sich alle Formen des Sexualverhaltens, nur sind die Geschlechtsbeziehungen sehr konfliktreich. Da nutzen weiße Erzieher, selbst Missionare, die Abhängigkeit ihrer Schüler aus, verheiratete Europäer halten sich schwarze Nebenfrauen, ganz im Sinne einer polygamen Gesellschaft, Alleinstehende pflegen Geschlechtsverkehr mit ihren männlichen oder weiblichen Angestellten, die gezwungen sind, das Bett nicht nur zu machen, sondern auch warmzuhalten, einige bleiben Stammgäste der Prostituierten-Szene…., nur wenige leben abstinent und ertränken ihren Frust im Alkohol. So hat jeder sein eigenes Heftpflaster für die Wunden der Einsamkeit und Isolation, dem akuten Mangel an Zärtlichkeit, von dem besonders Alleinstehende betroffen sind. Um dem zu begegnen, finden sich auch zwei weitere Verhaltensweisen als Konsequenz: die Flucht in die Ehe mit einer Einheimischen oder die der Resignation entspringende radikale Abkehr und ein Sich-Zurückziehen in die allen bekannten Weißen-Ghettos, die man überall in größeren Städten antrifft…“ (1)
Nervensystem, Organe und Hormone sind bei allen Menschen gleich.
Die Gesamtsteuerung des Organismus und das genetisch determinierte Grundbedürfnis Sexualität unterscheiden sich nicht bei verschiedenen Kulturen. Afrikaner haben keinen anderen Sexualtrieb als Asiaten, und diese unterscheiden sich in ihrer Triebstruktur nicht von einem Europäer. Niemand wird ohne Lustfähigkeit geboren. Wie aber Sexualität ausgedrückt, wie sie gelebt wird, ist bei jedem Menschen verschieden. Sexualität wird von vielen inneren und äußeren Faktoren beeinflusst, unterdrückt oder gefördert. Das, was wir tatsächlich tun, ist nicht nur inneren Zwängen unterworfen. Was uns sexuell anspricht, hängt von unserer Gesamtpersönlichkeit, dem Umfeld, der Kultur, der Gesellschaft, in der wir leben, und konkreten Erfahrungen aus der eigenen Erziehung ab. Der Mensch ist von Geburt an von sexuellen Bedürfnissen beeinflusst. Die Befriedigung durch Saugreflex und der direkte Hautkontakt zu den Eltern enthalten für das Neugeborene sexuelle Elemente lange bevor in der Kindheit irgendwann später die Genitalregion entdeckt wird. Aber obwohl Sexualität angeboren ist, muss sie dennoch als konkretes, soziales Verhalten erlernt werden. Freundschaft, Liebe und Bindung müssen selbst erfahren werden, und Sexualität lässt sich von diesen Faktoren nicht losgelöst betrachten. Auch wenn ganz unterschiedliche Ausdrucksformen existieren, immer ist der ganze Mensch mit seinen seelischen, geistigen, körperlichen und sozialen Qualitäten beteiligt. Bedürfnisse sind nicht einfach nur da, sie sind kein losgelöster Teil von unserem Wesen, und sie sind immer auch im Zusammenhang mit anderen Menschen zu sehen. Wir erhalten Informationen von anderen Personen, aus den Medien, sammeln eigene Erfahrungen, entdecken Neues, entwickeln und verändern Vorstellungen. Auch wenn Sexualität und Liebe im Leben ganz unterschiedlich verwirklicht werden, so besteht doch bei den meisten Menschen in nahezu allen Kulturen der Wunsch, Intimität in liebevollen partnerschaftlichen Beziehungen zu finden.
Sexuelles Verhalten ist in seinen Grundmustern auch in zunächst fremden Kulturen relativ leicht zu verstehen, wenn der Blick auf das eigene Ich, die eigenen Tabus gelingt. Dazu gehören auch die persönlichen Dissonanzen: versteckte Gedanken, geheime Wünsche, unerlaubte Gefühle, Diskrepanz zwischen Handeln im öffentlichen und im privaten Bereich. Die Ausdrucksform, der Umgang mit Sexualität variiert, wie die gesellschaftlich–kulturelle Wertung, die Beurteilung, die Ausgestaltung, die äußere Erscheinung, wie die Toleranz gegenüber Sexuellem oder die Repression. Hinter der Fassade gesellschaftlich-kultureller Konvention ist das tief Menschliche immer wieder ähnlich, auch wenn die äußere Form immer wieder neu erscheint.
Auch das folgende Zitat stammte aus einer nicht repräsentativen Befragung deutscher Fachkräfte und ist damit, wie jede Zusammenstellung persönlicher Eindrücke, völlig subjektiv.
Brasilien.
„… Die meisten Frauen (gemeint sind die an der Umfrage beteiligten) empfinden in Brasilien ein positives Körpergefühl; sie fühlen sich freier: weniger Klamotten bewirken ein angenehmes Körpergefühl, sie finden sich schöner, werden schöner gefunden, Sexualität ist im Alltag mehr präsent, der Körper wird mehr gepflegt („weil alle freundschaftlichen Kontakte nicht nur eine Kopf- sondern auch eine Körperkomponente haben“)…Eine Minderheit hat eine eher negative Wahrnehmung: weniger Spontaneität, hervorgerufen durch AIDS-Gefahr, Status als verheiratete Frau und den in Brasilien betriebenen Schönheitskult („ich fühle mich als Neutrum, weil ich als verheiratete Frau von brasilianischen Männern nicht mehr wahrgenommen werde“). Die Mehrheit der (deutschen) Männer nehmen Körper und Sexualität nicht anders wahr als in Deutschland. Für eine Minderheit wirken sich warmes Klima und fehlender Körperzwang positiv auf das eigene Körpergefühl aus („den Körper nehme ich häufiger wahr, die Sexualität ist offener“; „man nimmt viel mehr sexuelle Reize wahr“)…Für Frauen ist es deutlich problematischer, ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen als für Männer….“ (2)
Wären solche Interviews mit den gleichen Personen in einem anderen Land, nehmen wir zum Beispiel den Jemen, geführt worden, wären die Antworten sicher gänzlich gegensätzlich ausgefallen. Der Kontext, in dem Sexualität geschieht, wäre gegenüber Brasilien kaum unterschiedlicher zu denken gewesen. Sexualität im Alltag, auf der Straße wäre nicht präsent gewesen, einheimische Frauen wären entweder hinter Mauern oder hinter schwarzen Tüchern verborgen geblieben. Fehlt deshalb Erotik in diesem Land? Leben Expertinnen und Experten dort im Zölibat, wenn sie nicht verheiratet sind? Oder sucht sich Sexualität in den unterschiedlichsten Kulturen nur jeweils andere Wege?
Eine Wertung des zunächst Fremden verbaut den Blick, Wahrnehmen und ein „Auf-sich- wirken-lassen“ öffnet ihn.
Unser eigenes Selbst- und Fremdbild ist für die Wahrnehmung wichtig. Häufig lehnen wir Verhalten ab, dass unsere Vorstellungen umzustürzen droht. Wie kann für uns ein bisher unbekanntes Sexualverhalten sein, wenn der Gedanke daran uns selbst ängstigt, bedroht, anwidert?
In unterschiedlichen Kulturen ist nicht nur der Einfluss der traditionellen Gesellschaft auf Sexualität jeweils verschieden, sondern auch der Grad des gesellschaftlichen Umbruchs, das Zerbröckeln alter Werte, der Leistungsdruck, der Kampf ums Überleben. Armut, soziale Probleme, Prostitution für Einheimische und Touristen, Kirchenmoral und Machismo, Alkohol, Drogen bestimmen den Umgang mit Sexualität in jeder Kultur anders. Die Geschlechterrollen, Minderwertigkeit der Frau im gesellschaftlichen Bild diktieren den Grad der Gewalt, den Missbrauch, die Erniedrigung.
Der folgende Textauszug zeigt Sexualität als einen eindeutig nachgeordneten Lebensbereich neben dem Primärbedürfnis als Person oder als Sippe zu überleben.
Westafrika
„…..Amatokwu redete nur noch das Nötigste mit ihr. Als sie bei der Yamsernte waren, sagte er knapp: »Du kommst heute mit mir aufs Feld und arbeitest dort. Mein Kind kommt jetzt bald zur Welt. Deine junge Mitfrau bleibt zu Hause bei meiner Mutter.«
Bei der Feldarbeit kommandierte Amatokwu sie genauso herum wie alle anderen. Sie blieb mitten auf dem Feld stehen und sagte unvermittelt: »Amatokwu, weißt du noch, wie ich bei dir einzog? Weißt du noch, wie du hier, nur unter dem Schutz des Himmels, mit mir zusammensein wolltest? Was ist mit uns geschehen, Amatokwu? Ist es meine Schuld, daß ich dir kein Kind geboren habe? Glaubst du, ich leide nicht ebenso darunter?«
»Was verlangst du von mir?« fragte Amatokwu. »Ich habe viel zu tun. Ich habe keine Zeit, meinen kostbaren Samen an eine unfruchtbare Frau zu verschwenden. Ich muß Kinder zeugen, um den Bestand meines Namens zu sichern. Wenn du die Wahrheit wissen willst: du ziehst mich nicht mehr an. Du bist vertrocknet und ruhelos. Wenn ein Mann die Nähe seiner Frau sucht, will er seine Hitze loswerden und sich nicht an einer nervösen, dürren Frau wundscheuern.«
„Als ich zu dir kam, sah ich nicht so aus«, entgegnete Nnu Ego mit schwacher Stimme. »Oh, hätte ich doch den Stolz meiner Mutter«, rief sie gequält.
»Ja, dein Vater konnte sich ein Juwel wie seine Ona leisten, er hatte ja genügend Söhne, um seinen Namen zu verewigen. Und deine Mutter … du bist jedenfalls nicht wie sie. Ich werde meine Pflichten erfüllen. Ich werde dich in deiner Hütte besuchen, wenn meine Frau ihr Baby stillt. Doch jetzt hilf wenigstens bei der Yamsernte, wenn du schon keine Söhne gebären kannst.«
Auf dem ganzen Heimweg weinte Nnu Ego still in sich hinein. Zu Hause wurden sie mit der Nachricht begrüßt, Amatokwu sei Vater eines Sohnes geworden…“ (3)
Prägung der Wahrnehmung durch den eigenen Kontextwechsel
Black is a shade of brown. So is white, IF you look. John Updike
Die Brille der Wahrnehmung von Sexualität in einer zunächst fremden Kultur wird nicht nur durch die persönliche Grundeinstellung, sondern auch durch die Art bestimmt, wie ein kultureller Kontextwechsel persönlich verarbeitet wird. Die durch eigene Erfahrungen geprägte Sichtweise beeinflusst die Aufnahmefähigkeit für Verhaltensweisen der Menschen in einem neuen Gastland. Es lohnt daher, über die eigene Eingewöhnung in einen neuen kulturellen Kontext kurz nachzudenken, insbesondere dann, wenn Aufklärung und Verhaltensänderungen im Projektumfeld thematisiert werden sollen.
Menschen, die freiwillig aus ihrer eigenen in eine fremde Kultur reisen, um dort eine längere Zeit zu arbeiten, haben zunächst eine positive Erwartungshaltung, die je nach Temperament auch mit Ängsten vermischt ist. Vieles erscheint anfangs neu, exotisch, interessant, gelegentlich aber auch bedrohlich.
Über diese Phase des bewussten Fremdseins mit euphorischen und ängstlichen Stimmungsschwankungen kommen Touristen nicht hinaus. Erst im Rahmen eines längerfristigen Einlebens in die tägliche Routine werden zahlreiche, tiefergehend-enttäuschende und frustrierende Erfahrungen im Beruf und im Alltag erlebt, die zu negativen Gefühlsschwankungen führen. Die “interessanten und bunten Fremden” und ihre kulturspezifischen Lebens- und Umgangsformen beginnen langsam zu nerven. Eine berufliche Überforderung, die meist eine persönliche und interkulturelle ist, wird unterschiedlich stark deutlich.
Diese Krisenphase ist ein Durchgangsstadium eines Lernprozesses und spielt sich meist in den ersten Monaten im neuen Arbeits- und Lebensumfeld ab. Die Ausprägung variiert je nach Person oder Situation. Sie hängt u.v.a. ab von der vorhandenen oder fehlenden Partnerschaft, der bisherigen Auslandserfahrung, der Lage des Projektortes und den Versorgungsmöglichkeiten etc.
In der Konfliktphase kann die Enttäuschung über das Land und die Menschen dort zu Frustration, Abwehr, Jammern, Wehklagen führen und schließlich zum offenen Rassismus. Andererseits kann die Möglichkeit keimen, von den kulturell unterschiedlichen Menschen zu lernen.
Das Gefühl der Fremdheit und die gleichzeitige körperliche Nähe zu andersartigen Menschen kann irritieren, sexuelle Sehnsüchte oder Ängste auslösen. Das Selbstgefühl kann sich im Gastland verändern, die übliche Zurückhaltung, die Art des Wahrnehmens, der Respekt Anderen gegenüber. Allmählich können Menschen aus der neuen Kultur uns persönlich näher kommen, auch körperlich. Möglicherweise entsteht eine vorübergehende oder stabile Partnerschaft. Aber selbst wenn die neue Kultur auf Distanz gehalten wird, ist körperlicher Kontakt, wie käuflicher Sex, nicht selten.
Viele Lösungsmuster sind im Rahmen kultureller Lernprozesse denkbar. In jedem Fall sind sie für die Persönlichkeit prägend, bieten die Chance zur Persönlichkeitserweiterung und münden in der Regel, zumindest vorübergehend, in eine langfristige Stabilisierungsphase. Neben dem „Heimischwerden“ in der neuen Kultur, ohne eigenen Identitätsverlust oder dem definitiven Überwechseln aus der alten in die neue Kultur finden sich jedoch auch häufig Scheinlösungen wie der Griff zu Suchtmitteln (meist ein höherer Verbrauch an Alkohol und Zigaretten), Arbeitshyperaktivität, Flucht durch überstürzten Vertragsabbruch und Heimreise, widerwilliges Bleiben, nur weil es der Arbeitsmarkt über Jahre verlangt oder Abkapseln im Kreis anderer „Weißer“ und rassistische Verhärtung. Sexuelle Störungen können entstehen, die Risikobereitschaft kann gesteigert werden oder eine andere Art der Zufriedenheit macht sich im Rahmen der bestehenden oder einen neuen Beziehung breit.
Von der Art, wie diese Phase der Kulturanpassung durchlebt wird, hängt ab, wie offen und wirkungsvoll man oder frau für die Förderung von Aufklärungsmaßnahmen der sexuellen Gesundheit sein kann. Zum Beispiel würde sich ein pädagogisch hochqualifizierter Sozialwissenschaftler mit langer Berufserfahrung mit der Thematisierung sexueller Probleme mit Jugendlichen schwertun, wenn er im Gastland in Zynismus, Pessimismus und Alkoholabhängigkeit abgleiten würde, selbst wenn es ihm gelänge, zwischen Beruf und Privatleben eine Mauer aufzubauen. Die Trennung zwischen Professionalität und Privatheit ist bei der Bearbeitung technischer Vorgänge einfach, bei der Thematisierung von Sexueller Gesundheit jedoch häufig schwierig und gelegentlich sogar unmöglich.
Wirksame und unwirksame Aufklärung
Sexualität ist nicht reduzierbar auf die Risiken, mit denen uns viele Aufklärungsbroschüren den Spaß am Leben verderben wollen: AIDS, Geschlechtskrankheiten, sexuelle Gewalt und ungewollte Schwangerschaften. Sexualität beinhaltet die Wärme der Haut fühlen, ein Gesicht sehen, einen Duft einsaugen, um etwas kämpfen, jemanden beherrschen, sich jemandem ergeben, es bedeutet Ruhe, Ekstase, Wildheit, Kuscheltrieb und Geborgensein und vieles mehr.
Lebenslust, Emotionalität und erotische Gefühle sind irrational. Sie gelten deshalb in vielen Kulturen, auch häufig im Alltag der unseren, als potentiell gefährlich, subversiv oder zumindest suspekt.
Die rationale Erziehung, die Aufklärung über das gesellschaftlich notwendige Rollenverhalten und repressive Kontrolle konzentrieren sich nicht auf den Spaß, sondern auf die gelegentlich auch dramatischen sexuellen Risiken. Oft wird direkt mit Angst gearbeitet; „AIDS tötet!“, „Einer Familie mit mehreren Kindern droht Hunger!“. Persönliche Energien sollen in das gesellschaftlich als nützlich und notwendig erkannte kanalisiert werden oder dem zumindest nicht entgegenstehen. Der Sexualitätstrieb aber kommt „aus dem Bauch“, besser aus dem Hirnstamm und nicht aus der linken (rationalen) Gehirnhälfte, in der die Vorschriften und Verordnungen gespeichert werden. Gesundheitsaufklärung, die das Denken beeinflussen will und nicht an emotionalen Bedürfnissen ansetzt, stützt sich auf Daten, Tabellen und Fakten über die Zunahme der Risiken, setzt auf die Kontrolle der Triebstruktur durch den erhobenen Zeigefinger und die Wirkung des Bildes eines AIDS-Kranken. Übersehen wird dabei:
Angst führt oft kurzfristig zu Verhaltensänderungen, aber langfristig zur Verdrängung. Raucher „rauchen gerne“ trotz ihres Wissens um die Gefahr des Lungenkarzinoms. Bei AIDS beobachten wir ein ähnliches Phänomen wie bei dem Verlauf des Pilzkonsums nach Tschernobyl: bei konstantem Risiko (bei gleichbleibender Konzentration der langsam abbaubaren radioaktiven Substanzen in Pilzen nach dem Unfall) reduzierte sich der Pilzverbrauch zunächst drastisch (Angstphase) und schwankte wenige Jahre später wieder auf das Vorunfallniveau zurück (Verdrängungsphase). Grundbedürfnisse sind langfristig stärker als Angst, sie schieben sie weg oder ersäufen sie notfalls im Alkohol.
Sexualität hängt nicht nur von den handelnden Personen ab, sondern von dem familiären, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext. Ein Individuum bestimmt sein Verhalten in engen Grenzen und kann es nicht immer ändern. Die Angst vor Risiken kann das Verhalten nicht beeinflussen, wenn keine freie Entscheidungsmöglichkeit besteht. Eine verschüchterte Frau, die in einer kirchlichen Beratungsstelle gelernt hat, an Hand einer Perlenkette ihre unfruchtbaren von den fruchtbaren Tagen einigermaßen zu unterscheiden, mag motiviert sein, ihren Mann zu überzeugen, an einem bestimmten Tag nicht mit ihr zu schlafen. Aber vielleicht hat er gerade in dieser Nacht Lust auf sie und vergewaltigt sie schließlich, weil er betrunken ist. Oder eine Prostituierte möchte Kondome benutzen, wird aber von dem Zuhälter gezwungen, auf die Kundenwünsche nach „Sex ohne“ einzugehen.
Die wesentlichen, mit dem Eingehen oder Erleiden sexueller Risiken verbundenen Faktoren sind: Armut, Elend, Hunger Ferner: fehlende Zukunftsaussichten, oder noch schlimmer: Hoffnungslosigkeit, allgemeine Unwissenheit, Unkenntnis risikomindernder Verhaltensweisen, mangelnde Verfügbarkeit von Kondomen und Empfängnisverhütungsmitteln, niedriger gesellschaftlicher Status, niedrige Position und geringer Entscheidungsspielraum von Frauen, niedriges Selbstwertgefühl, fehlendes Selbstvertrauen, Missbrauchserfahrung, Suchtverhalten, Alkohol-, Tabletten-, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit und fehlende persönliche Freiheit, Zerstörung von Kultur und Lebensraum, negative Grundeinstellung zur persönlichen Umwelt: Gier, Haß, Neid, Nihilismus, Narzissmus.
Für eine Frau, die von Empfängnisverhütungsmitteln zwar gehört hat, sie aber nicht beschaffen kann und deren Mann die Einnahme verhindern würde, ist Sexualität nicht lust- sondern angstbesetzt. Ein seit dem Kleinkindalter von seinem Onkel missbrauchter Stricher ist in seiner Persönlichkeit zerstört und hat andere Probleme, als an Kondome zu denken. Eine durch Krieg vertriebene Frau muss ihre Kinder durchbringen und nutzt Sex als Mittel zur Beseitigung des Hungers, der prioritärer ist als Geschlechtskrankheiten oder eine drohende Abtreibung. Ein zwölfjähriges Mädchen hat keine Möglichkeit, sich gegen die Vergewaltigung in der Ehe zu wehren. Ein anderes wollte den Nachbarjungen eigentlich nur küssen, hatte keine Ahnung, was sonst in dem Hinterhof noch auf sie zukam und betrachtet einige Monate später verschreckt ihren rundlichen Bauch und die trübe Zukunftsaussicht.
Risikoarmes Verhalten ist abhängig von dem Recht über seine eigene Sexualität selbst zu bestimmen. Und von persönlicher Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstbestimmung, Grundbedürfnisbefriedigung und Chance der sozialen Entwicklung, Bildung und Wissen, kultureller Identität, Zeit für Spielerisches und Erotik, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstachtung, Positiver Grundeinstellung zur persönlichen Umwelt: Optimismus, Verantwortungsgefühl, Fähigkeit zur stabilen Partnerbindung, Verständnis für andere, Vertrauen, Offenheit, Wohlbefinden, Ruhe, Gelassenheit, Spaß am Leben.
Ein Mann, der beim Kondom-überziehen lachen kann, hat die Technik vermutlich gut im Griff und geht damit ein geringeres Risiko ein. Eine Prostituierte, die sich stark fühlt, zwingt ihren Freier zur Kondombenutzung, oder schmeißt ihn raus. Eine selbstbewußte Frau, die auf einen verständnisvollen Mann trifft, kann mit ihm ihre Gedanken zu Empfängnisverhütung oder Kinderwunsch klären. Ein Jugendlicher der mit seinem Schwarm ins Bett will, aber nicht weiß, wie er das anstellen soll, macht einen Bogen um eine angstbezogene Thematisierung des Gespenstes „AIDS“, aber wäre vermutlich neugierig, wenn „Lebenslust statt Jugendfrust“ im Vordergrund stünde und AIDS nur scheinbar nebenbei zur Sprache käme.
Wesentliches Ziel jeder Aufklärungsmaßnahme ist die Stärkung des Selbstwertgefühls derjenigen Betroffenen, die sich als Sexualpartnerinnen oder -partner in einer schwächeren Position befinden.
Unterschiedliche Formen der Förderung von Maßnahmen der „Familienplanung“ oder der „AIDS-Bekämpfung“ sind nicht nur in der verschiedenen Qualität der Vorkenntnisse, sondern auch in der jeweiligen persönlichen Einstellung der Projektverantwortlichen begründet. Jemand, der selbst frei mit Sexualität umgeht, fördert eher eine Maßnahme, die „Safer Sex“ propagiert; ein eher verschlossener Mensch dagegen lieber die Gegenbewegung, die zu „Say NO!“ ermuntert.
Wenn sexuelle Risiken reduziert werden sollen ist es gar nicht nötig, sie direkt oder explizit anzusprechen. Maßnahmen zur Stärkung der Position von Frauen, die zu positiven Veränderungen im Geschlechterverhältnis führen, vermindern zum Beispiel sexuelle Risiken nebenbei. Eine friedliche gesellschaftliche Entwicklung zu bescheidenem Wohlstand und zu besseren Bildungsniveau führt zu reduziertem Gebärzwang und kleineren Infektionsrisiken. Die Förderung von Entwicklungsmöglichkeiten von Jugendlichen bietet Zukunftsperspektiven und senkt den Drang zur Flucht in Suchtmittel oder unbefriedigenden Gelegenheitssex in einer dunklen Straßenecke.
Für Expertinnen und Experten ist es manchmal schwierig, offen über Sexualität zu reden. Da sind Hemmungen und Scham, und vielen von uns fehlt ganz einfach die ,,Übung“ im Umgang mit diesem Thema. Trotzdem sollten Sie sich selbst nicht unter Druck setzen, indem sie glauben, unbedingt Dinge ansprechen zu müssen, die Ihnen unangenehm sind, bei denen sich vielleicht nicht genug auskennen oder bei denen sie nicht wissen, wie sie das Gemeinte ausdrücken sollen. Sexualerziehung ist nicht einmalige Aufklärung, sondern ein langer Prozess. Vielleicht kann es für beide Seiten eine Entlastung darstellen, wenn Sie anderen zu erkennen geben, dass es für Sie schwierig ist, über bestimmte Arten der Sexualität zu reden. Eine solche Ehrlichkeit dürfte befreiend sein für das gemeinsame Gespräch bedeutet dies, sich selbst und anderen nichts aufzuzwingen. Es gibt auch eine verkrampfte Offenheit. Diese entsteht, wenn man glaubt, etwas tun oder sagen zu müssen, weil es vielleicht liberal oder gerade ,,in“ ist. Sexuelle Freizügigkeit muss nicht automatisch schon gute Sexualerziehung sein. Sehr positiv wirkt sich auch aus, wenn Sie mit Kolleginnen und Kollegen darüber reden, wenn sie zur Sprache bringen, was sie verbindet und wo verschiedene Auffassungen vorhanden sind. So können sie eigene Schwierigkeiten und Hemmungen ausloten.
Grundsätzlich ist es wichtig, bei Sexualaufklärung zuzuhören, Ängste und Ungesagtes versuchen zu erfühlen und auf Fragen eingehen. Frontalvorträge über Sachthemen, wie die Eiweißstruktur des HIV/AIDS – Virus führen selten oder nie zu nachhaltiger Beeinflussung des Verhaltens.
Im Rahmen der Sexualerziehung haben auch Aufklärungsschriften einen hohen Stellenwert. In entsprechenden zielgruppenspezifischen Bücher, Broschüren oder Comics kann man oder frau dann hineinschauen und dort etwas nachschlagen, wenn sie oder er ungestört und aufnahmefähig sind. Broschüren und andere Materialien müssen Lust machen zur Weiterbeschäftigung mit dem Thema. Sie sollten ansprechen, anregen, aber nicht drohen und Angst – machen.
Geschichten
Die folgenden Texte sind Illustration unzählig vieler Varianten über das älteste Thema der Welt. Jeder von uns würde die geschilderten Situationen anders erleben oder unter anderen Blickwinkeln beobachten. Die Sexualität anderer Menschen sehen wir nur durch unsere emotionale Brille. Eine objektive Wahrnehmung ist hier ausgeschlossen. Häufig neigen wir dazu, unmittelbar mit der Wahrnehmung eine Wertung zu verbinden, „positiv“ oder „negativ“, „gender-gerecht“ oder „machistisch-chauvinistisch“, „gesellschafts-konform“ oder „abartig“.
Versuchen Sie bei der Beobachtung der geschilderten Alltag- und Allerweltssituationen die Wertung jedoch zunächst zurückzustellen. Lassen Sie spontane Assoziationen zu. Stellen Sie sich vor, Sie seien beteiligt oder ein den Akteuren sehr naher Zuschauer. Welches Happy-End würden Sie ansteuern oder empfehlen? Gibt es für Sie immer eine einfache Lösung oder einen eleganten Ausweg?
One Night Stand
Alexander ist als Experte in einer extrem ländlichen Gegend tätig, die häufig von einheimischen Fachkräften als Ort der Strafversetzung gefürchtet wird. Nach wochenlanger Arbeit in der Abgeschiedenheit von Dörfern und Staubpisten verschlägt es ihn endlich wieder in die nächste Großstadt. Er stürzt sich am Abend in das Nachtleben, freut sich über das abwechslungsreiche Essen und trinkt reichlich in einem Terrassen-Café am quirrligen Marktplatz. Hier wimmelt das Leben und Gerüche von Gewürzen und fauligem Obst mischen sich mit Stimmengewirr und den neusten Schlagern und dem Verkehrslärm. Er genießt die weichen Bewegungen hübscher Mädchen, die Körbe auf ihren Köpfen balancieren oder mit Freundinnen kichern. Anschließend bummelt er langsam über die Straße und geht auf ein Bier in eine Disco, die schon etwas bevölkert aussieht. Nach etwa einer halben Stunde des Zuschauens von der Bar aus, steuert eines der Mädchen auf ihn zu. Heute stört es ihn nicht angemacht zu werden. Er ist leicht angetrunken und genießt es, sich gehen zu lassen. Es tut ihm gut, einen warmen, weichen Körper zu spüren, erotisch zu tanzen, und irgendwann, Stunden späterer verbringt er mit ihr schließlich eine für ihn sehr befriedigende Nacht.
Am nächsten Morgen, als er sie zur nächsten Bushaltestelle bringt, wird ihm klar, daß er keine Kondome benutzt hat. Ihn packt Panik. Er hat gehört, viele „Prostituierte“ sollen infiziert sein. Kondome hatte er sogar dabei! Er macht sich Vorwürfe, fragt sich ob es das wert war, und weiß nicht wohin mit sich. Am liebsten würde er mit einem anderen darüber reden, doch intime Dinge waren für ihn noch nie ein offenes Thema, abgesehen von lockeren Sprüchen in der Kneipe…Ihm fehlt genügend Vertrauen zu anderen Menschen, um sich mit seinen Fragen zu öffnen, und er beruhigt sich mit einem wenig später durchgeführtem HIV-Test, der negativ ausfällt.
Aus der Sicht beteiligter Frauen stellen sich ähnliche Situationen ganz anders da:
Zaïre (Congo):
„… sie nimmt die Aufforderung eines Amerikaners zum Tanz an. Wieder ist sie Wachs in den Händen des Mannes, und mit lebhafter Farbe und plötzlich fröhlichen Augen singt sie mit dem Orchester…….Er spricht zu ihr, und ergriffen lauscht sie der Stimme, in der etwas Bittendes liegt, die ein wenig unglücklich klingt. Warum nimmt er sie nicht gleich mit? Er versteht nicht, dass sie sich so sehr dagegen wehrt, Geld anzunehmen, und er entfaltet ein riesengroßes Taschentuch, um sich damit über das Gesicht zu wischen. Sie sieht ihn an, sucht seine Augen und bricht dann in Lachen aus. Gibt sie nach? Sie kennt diese Augen eines geschlagenen oder durchnässten Hundes. Sie übt die Macht aus, und sie weiß, dass sie, sobald sie sich angeboten hat, keinen Widerstand mehr leisten kann, wenn sie sich ihre Belohnung verdienen will; dann wird sie es sein, die mit niedergeschlagenen Augen dasteht.
Belustigt folgt ihr Blick der Hand, die schüchtern ihre Schenkel knetet. Eine behaarte Hand. In dem schwachen Licht sieht sie aus wie der Panzer einer Schildkröte. Die Venen treten beherrschend heraus. Sie hebt ihr Glas bis in Augenhöhe und betrachtet aufmerksam die Eisstückchen, die im Whisky schwimmen und wie Diamanten funkeln. Sie lächelt glücklich und lässt (…) ihren Blick in eine dunkle Ecke streifen. Ein Paar sitzt dort, wie sie beide ein Amerikaner mit einer Negerin. Sie zündet sich eine Zigarette an und nimmt zwei Züge hintereinander. Ein langsames Lied. Er sieht sie an, und sie macht die Zigarette aus.
,,Wollen wir tanzen?“ Ja … Er schmiegt sich an sie, hält sie gefangen. Das Licht wird schwächer. Sie drücken sich aneinander… ,,Was machen Sie im Leben?“ ,,Ich bin Amerikaner.“ ,,Das sehe ich; aber was ist Ihr Beruf?“ ,,Ich bin Techniker.“ ,,Sie tanzen gut!“
Er hat beide Hände auf deine Hüften gelegt. Seine Arme bilden wie doppelt geschlungene Lianen eine Verbindung zwischen euch. Nur eure Schultern treiben in kaum bemerkbaren Wellenbewegungen dahin…..,,Immer noch zufrieden?“ ,,Indeed. Abgesehen von der Hitze. Ich ersticke hier. Wie heißt du?“ ,,Interessiert Sie das wirklich? Erzählen Sie mir lieber von Ihrer Heimat!“ …. ,,Vielen Dank, du kleines Mädchen ohne Namen!“ ,,War es schön?“ ,,Indeed. Ich habe den Text gern. Kennst du den Verfasser?“ ,,Nein, warum?“ ,,Warst du nicht auf der Schule?“ ,,Aber sicher! Ich spreche doch französisch!“
Eine Katastrophe! Er erzählt dir von langweiligen deutschen, englischen und amerikanischen Schriftstellern. Plötzlich kannst du dich losmachen und glücklich derjenigen zulächeln, die auf dich zukommt. Auch er hält mit seiner Rede inne, um sie, wie sich deutlich erkennen lässt, mit seinen Blicken auszuziehen. Sie trägt ein kurzes Kleid in den Farben Gelb und Orange, das einen tiefen Ausschnitt hat. Wieder musst du den schönen Schwung ihrer Augenbrauen bewundern und ihre Zähne, die im Neonlicht bläulich schimmern. Schnell flüstert sie dir zu: ,,Holst du mich morgen um zehn Uhr ab?“ ,,Am üblichen Platz?“ ,,Ja, wenn es dir recht ist.“ Seine rechte Hand hat er unter deinem Rock, und er sieht ihr fasziniert nach, wie sie zur Theke geht. ,,Ist das deine Freundin?“ ,,Nein, meine Schwester.“ ,,Sie ist aber hübsch!“ ,,Sicher!“ Du mußt schallend lachen. Als ob sie deine Schwester wäre! Letztlich sehen sich für Europäer und Amerikaner alle Schwarzen ähnlich. Es ist viel einfacher, wenn sie deine Schwester ist!
…..Plötzlich hast du deine Beine wieder geschlossen, und du bist aufgestanden. ,,Lassen sie mich! Sie tun mir weh!“ ,,Mein aufrichtiges Bedauern, ich. . ,,Nein, lassen sie mich!“ Er scheint verärgert zu sein. Mit einem Zug hat er sein Glas Whisky geleert und sich dann auf die Suche nach einem anderen Mädchen gemacht….“ (4)
Thailand
„….Michael Denhart war nun also zum dritten Male in Pattaya gewesen. Er war einer meiner angenehmsten Kunden, wirklich sehr großzügig und dabei treu im Sinne von finanzieller Zuverlässigkeit. Er war mein hartnäckigster Freier – diesmal in der wohlanständigen Bedeutung des Wortes.
Beim Abschiedsessen im Mai Kai-Restaurant hatte er mir ein Kuvert überreicht. Ich fühlte mich beklommen, denn darin entdeckte ich einen datumsoffenen Flugschein der Singapore International Ajrlines von Bangkok nach Frankfurt, der auf meinen Namen ausgestellt war. Ich fand, daß er einen Schritt zu weit gegangen war, vor allem, weil das Ticket keinen Rückflug einschloß, und reagierte »asiatisch«. »Du lächelst wieder einmal unergründlich«, meinte er unsicher.
Michael war ein hübscher, athletisch gebauter, geschmeidiger Mann mit seltsam weich wirkenden Gesichtszügen. Die Zeit mit ihm empfand ich als verhältnismäßig angenehm. Er mochte die fernöstliche Küche, dies beseitigte ein wesentliches Problem des Zusammenseins mit Farang. Und er war sportlich tätig. Dies füllte die Tage aus und brauchte die Nächte für den Erschöpfungsschlaf. Wir standen früh auf und nutzten den ganzen Tag für die Sportarten, die sich in Pattaya anbieten: Reiten, Schwimmen, Tauchen, Segeln, Wasserski und Fallschirmsegeln. Unsere Müdigkeit abends vergrößerte sich noch dadurch, daß wir ausgiebig aßen und noch eine oder zwei Flaschen Bier tranken. Dann war es Zeit irs Bett, denn wir wollten den nächsten Tag munter beginnen. Seine sexuellen Ansprüche an mich waren meist auf die Zeit des Morgengrauens begrenzt. Der Körper war nach tiefem Schlaf taufrisch, drängte aber auch schon ans Tagwerk. So blieb in seinem Energiehaushalt nur Zeit für einen »Quicky«. Mir sollte es recht sein. Allerdings denke ich, dass ich sogar ein wenig Spaß daran gehabt hätte, mit ihm zu schlafen, wenn er sich mehr Zeit dafür genommen hätte. Denn er war körperlich anziehend, hatte keinen Kratzbart, roch nicht aus dem Mund, und vor allem war er sehr unterleibs-pflegebewußt. Er belästigte mich nicht in der Nacht und war tagsüber ein lustiger und unternehmungslustiger sportlicher Kamerad. Da hätte das Schlafen miteinander durchaus auch für mich eine saubere, angenehm lustvolle Zweisamkeitsgymnastik sein können.
Manchmal fragte ich mich, warum er so viel Geld für mich ausgab und warum er so treu nur auf mich bezogen war. Zu Zeiten schien er mir doch etwas oberflächlich und glattpoliert. Er zeigte mir Bilder von seinem Leben in München: vor seinem BMW mit Windsurfbrett auf dem Dach, als Vertreter mit Nadelstreifenanzug und Diplomatenköfferchen im Jogginganzug mit Stirnschweißband, vor seiner Stammkneipe in Schwabing. Jung, dynamisch, erfolgsorientiert, »sportiv«, attraktiv – ein ganzer Frauentyp? Dann aber gab es die Augenblicke, in denen er sich abends doch noch ein Bier bestellte, die Schultern hängen ließ und in eine für mich unerklärlich traurige Stimmung verfiel. Dann legte ich meinen Mietkontrakt freiwillig so großzügig aus, dass ich seine Hand streichelte, aufmunternde Worte fand und mich fast zärtlich fürsorglich um ihn bemühte. Vielleicht rührte seine starke Bindung an mich daher. Schon bei seinem ersten Besuch in Pattaya, vor etwa einem Jahr, hatte er mir einen Heiratsantrag gemacht. Ich hatte einfach lächelnd abgewehrt. Er war nicht aufdringlich mit seinem Ansinnen, aber er gab doch immer wieder Signale ab.
Ich steckte das Flugbillet ein, um den Anstoß meines Ärgers vom Tisch zu nehmen, denn ich wollte ihm seinen letzten Abend in Pattaya nicht vergällen…“ (5)
Haiti:
„….La Nina Estrellita empfindet ihr Geschlecht wie eine offene Wunde mit auseinanderklaffenden Rändern, wie ein Riß oder vielmehr wie eine wundgeriebene, brennende Ferse in einem zu weiten Schuh… Wie von Sinnen stößt er in sie hinein, grunzt wie ein Schwein in der Schule, rücksichtslos den passiv hingegebenen Leib unter sich zerquetschend… Oh! Dieser hämmernde Schmerz hinter den Augenhöhlen…! Das kommt vom Bier. Pabst-Bier verträgt sie nun mal nicht……
La Ninia Estrellitas Unterleib ist ein einziges schwitziges, empfindungsloses Brett, das dennoch bebend auf und ab wogt, mechanisch wogt, von Berufs wegen wogt, trotz allem wogt, immer weiter wogt unter dem darauf gepreßten Wanst. Mit dem Oberkörper zermalmt ihr der Schlacks die Rippen, und sein Kopf, ein Wedel roter Haare von fadem Geruch, scheuert unablässig über das hingebungsvolle Madonnengesicht der kleinen Nutte, die mit bitterem Blick die Decke anstarrt. Mit einem Ruck wirft sie sich leicht zur Seite.
… Stoßweise streift sie der eklige Geruch des Mannes, der nach Whisky, zerdrückten Wanzen und Katzenpisse stinkt… Ab und zu schiebt der Yankee seine fetten Beine über die Kniescheiben seiner Partnerin und läst die Knochen übereinander kreiseln, bis La Ninia Estrellita ihren unermüdlichen Reiter mit einem Ruck wieder abwirft… er merkt nicht, welcher Tortur er sie damit unterzieht. Dreckschwein! Er miaut, jault klagend wie eine Hawaii-gitarre, schnurrt atemlos in rhythmischen Synkopen, als summte er irgendein eintöniges Cowboylied, voller Sehnsucht nach seiner weiten Prärie… Und immerzu diese Musik…! Estoy equivocado, Equivocado esta-a-a…
Kriegen die denn nie genug…? La Ninia drückt plötzlich voller Zorn ihre Fingernägel in den Nacken des behaarten Menschen. In seiner Entrückung scheint er es nicht einmal zu spüren. Mit einem Mal richtet er sich rittlings auf seiner Stute auf und ergießt in ihr seine Säfte, das traurige, schmierige und brennende Sperma eines geilen Trunkenboldes. Dann gibt er noch ein dumpfes Röcheln von sich, beugt sich vor, bereit, von neuem zu beginnen… Er will noch mal…! »Nein, nein, du Schwein…! Jetzt reicht’s! Du wirst zahlen und abschieben! Hör auf damit – du hast schon alles vollgespritzt. . .
La Nina Estrellita stößt ihn so heftig von sich, daß er auf die andere Seite des Bettes rollt! Sie reckt und streckt ihre schmerzenden Glieder. Er blickt sie etwas verstört mit großen Augen an:
„Ugh! What’s wrong…?“ „Ich hab gesagt, daß es jetzt genug ist…! Ist doch nicht zu fassen! Viermal hintereinander! Entiendes? Four times! No…….! Finished…! Scher dich zum Teufel…!“ „What’s wrong?“ hebt dieser von neuem an. „I’ll pay… No…?“ „Ich hab nein gesagt, du Ferkel. . .! No; No mas! No more…! Es ist genug! Los pack dich…! Get out.. .! Du willst also nicht kapieren? Ist denn das die Möglichkeit! Na warte, du wirst schon sehen…!“
Sie richtet sich auf, fährt sich mit wirrer Hand durchs Haar, krallt sich fest im dichten Pelz und krault zerstreut die Kopfhaut. Dann setzt sie die Füße auf den Boden, steht langsam auf, macht zwei, drei Schritte… Die Gelenke ihrer Zehen knacken… Der Kopf schwindelt ihr… Als sie am Schrankspiegel vorbeikommt, wirft sie einen Blick auf ihre bläulich schimmernde Nacktheit… Wie viele Jahre wird sie sich wohl noch halten können, wenn sie so weitermacht? Wie lange noch werden ihre Brüste auf derselben Höhe bleiben? La Nina Estrellita! 0 weh! Möge es eine Weile noch gehen…! Sie dreht die blaue Flut ihrer Haare zusammen und wirft sie über die linke Schulter. Ihre nackte Silhouette wankt im Spiegel. Sie muß sich an der Wand festhalten.
Der Mann ist endlich in die Wirklichkeit zurückgekehrt. Er kommt allmählich zu sich, hat sich hingestellt, durchsucht seine auf den Stuhl geworfenen Kleidungsstücke und fingert ein Bündel Dollars heraus, die er ihr mit einem einfältigen Grinsen hinstreckt. Er ist großzügig, da gibt’s wenigstens keine Diskussion. La Nina Estrellita geht auf ihn zu, greift sich das Geld, schiebt sich an den Marine heran, reibt sanft ihre Schenkel gegen die ihres Kunden und die Brustspitzen gegen seine behaarte Brust und drückt ihm drei, vier flüchtige Küsse auf denMund: „Mmiuu… mmiuu… mmiuu…! Danke, mein Süßer…!“ Seinem guten Ruf ist man schon was schuldig… Dann stößt sie den Marine sacht, aber bestimmt zurück: „So, mein Täubchen…! Du bist allerliebst, aber ich bin hundemüde, verstehst du…? Tired out! Los, geh!“
Sie schenkt ihm noch ein Lächeln,…. knüpft ihm die schwarze Krawatte um den Hals und läßt ihn kurzerhand stehen, um beim Waschbecken das Geld zu verstecken. Was für ein Beruf…! Glockengeläut ertönt….“ (6)

Eine Beziehung
Sonja lebt als Expertin seit einem Jahr in Afrika. Vor einigen Wochen lernte sie einen einheimischen Lehrer kennen. Er ist ein anregender, intelligenter, politisch engagierter und eloquenter Mann. Sie genießt es, dass er über den Tellerrand seines eigenen Landes hinausblickt, und sie mit ihm über alles Mögliche diskutieren kann. Gleichzeitig erfährt sie von ihm vieles über die Kultur seines eigenen Landes, was ihr sonst verschlossen geblieben wäre. Sie lernt ihn schätzen und seine körperliche Nähe und zärtliche Aufmerksamkeit tun ihr sehr gut. Ihrer Freundin schreibt sie: “Ich glaube, ich bin dabei, mich richtig zu verlieben.“
Sie befürchtet, dass er noch zu einer alten Freundin sexuelle Beziehungen haben könnte, wenn er gelegentlich für mehrere Tage in die Hauptstadt fährt. Sie will es jedoch so genau gar nicht wissen, da ihr viel zu unklar ist, was aus dieser Beziehung einmal nach dem Ende ihres Aufenthalts werden soll.
Die Freundin aus Deutschland kommt unerwartet zu Besuch. Sie mache sich Sorgen, ist voller Unverständnis und überhäuft die eigentlich mit sich und ihrer Beziehung zufriedene Sonja. Es entbrennt ein Streit, über Verantwortung, Erotik und Käufliches zwischen Europäern und Afrikanern, und schließlich über das Eingehen sexueller Risiken.
Diese Auseinandersetzung wirkt später in ihr lange nach. Sie ist verunsichert. Wieso Verantwortung? Hat seine Liebe tatsächlich etwas mit ihrem relativen Reichtum zu tun? Und wenn es so wäre? Solange ihre Abreise noch Jahre entfernt ist, erscheint es ihr überflüßig, nach Lösung zu suchen. Es geht ihr besser, wenn sie die Tage und Nächte genießt ohne alles zu hinterfragen.
Schwarz und weiss
„…. Aus dem schwärzesten Teil meiner Seele, durch die schraffierte Zone hindurch steigt der Wunsch in mir hoch, auf einmal weiß zu sein. Ich will nicht als Schwarzer; sondern als Weißer anerkannt werden. Wer aber – und diese Erkenntnis hat Hegel nicht beschrieben -, wer kann das tun, wenn nicht die weiße Frau? Indem sie mich liebt, beweist sie mir, daß ich einer weißen Liebe würdig bin. Man liebt mich wie einen Weißen.
Ich bin ein Weißer. Ihre Liebe öffnet mir den berühmten Durchgang, der zur totalen Prägnanz führt Ich vermähle mich mit der weißen Kultur, der weißen Schönheit, der weißen Weiße. In diesen weißen Brüsten, die meine allgegenwärtigen Hände streicheln, mache ich mir die weiße Zivilisation und Würde zu eigen…..“ (7)
„….Die sexuelle Lust der Frauen segelt unter romantischer Flagge….Der „Südmann“ – ob Afrikaner, Latino oder Türke – umschwirrt die „Nordfrau“, gibt ihr das Gefühl „strahlender Weiblichkeit“ und sich selbst das Statussymbol sexueller Freizügigkeit, materieller Vorzüge und vielleicht die Hoffung auf ein besseres Leben im reicheren Land…Sie macht Geschennke, lädt ein, nimmt ihn mit auf die Reise oder finanziert einen Flug…Die Bezahlung ist nicht klar geregelt. Sie spielt sich verschämt in tradituionellen Rollenmustern ab, sie kommt oft als Liebesdienst daher. Die Frau hilft, unterstützt, leidet mit….Frauen brauchen Nähe, Vertrauen…Sie suchen nicht den schnellen Sex, den one-night stand. Das kommt sicher auch vor, ist jedoch die Ausnahme… Und in einer solchen Beziehung stört schon das Kondom, ist quasi Vertrauensbruch….Die Frau also letztlich Opfer patriarchalischer Selbstherrlichkeit: hereingelegt von polygamen männlichen Strandschönheiten? Mitnichten. Sie ist auch romantische Lusttäterin, die sich holt was sie braucht und wie sie es braucht.“ (8)
Vor der Rückkehr nach Deutschland
Thomas wird in drei Monaten wieder nach Deutschland zurückkehren. Seit eineinhalb Jahren ist er bereits mit einer Frau aus seinem Projektort befreundet. Am Anfang seines Aufenthalts war er ziemlich einsam, bis er sie beim Einkauf in einem Kramladen kennenlernte. Aus einer eher zufälligen Affäre wurde Zuneigung und Liebe. Als sie über ihren Kinderwunsch spricht, verspricht er, sie zu heiraten. Kurz danach kommen ihm große Zweifel.
Wie soll seine Frau in Deutschland zurechtkommen? Sie spricht nicht einmal die Kolonialsprache des Landes fehlerfrei und hat keinen vernünftigen Beruf erlernt. Nimmt sie weiterhin die Pille regelmäßig oder möchte sie ihn mit einer Schwangerschaft binden? Wie würden Eltern, Verwandte und Freunde zu Hause darüber denken? Welche Erfahrungen gibt es mit gemischten Paaren in Deutschland?
Plötzlich ist er sich nicht mehr sicher, ob er mit ihr sein Leben verbringen will. Kennen sie sich überhaupt gut genug, oder sind sie sich nicht doch immer irgendwie fremd geblieben? Er fühlt sich aber irgendwie moralisch verpflichtet. Das Problem überfordert ihn. Er weiß nicht, mit wem er es besprechen kann. Er beginnt nach Auswegen zu suchen, wie er sich irgendwie, elegant aus der Affäre ziehen kann.
Aus einheimischer Sichtweise stellt sich diese immer wieder neue Situation zum Beispiel so dar, wie hier in Thailand:
„… Mein Kurs im Goetheinstitut war zunächst beendet, und Benjamin hatte noch Urlaub aufgespart. Wir entschlossen uns, in den Süden zu reisen…
Wir mieteten einen Fischersampan und Angelgerät, besorgten ein Sonnensegel, Tauwerk, Decken, Kochgeschirr, Kochvorräte und vor allem große Plastikballons für den Trinkwasservorrat…Nach stundenlanger Fahrt machten wir an einer weit draußen im Meer gelegenen kleinen Insel fest, fern von menschlichen Wesen…..
…..Nun war alles vorbereitet, um einen fast kitschigen urmenschlichen Taum zu erleben: zwei Liebende allein auf einer fernen, paradiesischen Insel. Wir zogen uns aus und blieben all die Tage splitternackt. Unsere erotische Anziehung füreinander war unverschleiert und ohne Umwege. Wir erprobten sogleich die Biegsamkeit unseres Bettes und fanden das Knarzen, Ächzen und Stöhnen des Bambus so aufregend, daß dieses Geräusch allein schon unwiderstehlichen Lockruf bedeutete. Danach hockte ich im flachen Meereswasser wie ein amphibisches Vorzeitwesen. Das warme Wasser ließ den Samen zu Klümpchen gerinnen, und kleine Krebse entdeckten eine proteinhaltige Delikatesse.
Unsere Nerven stärkten sich durch das Rauschen des Meeres und den feinen Hauch der Brise. Unsere Haut tönte sich schnell, um nicht zuviel Sonnenkraft aufzusaugen. Benjamins Bartstoppeln sprossen, und die bleichende Sonne und das Meerwasser holten ein Kunterbunt von Farben hervor, sogar Rot entdeckte ich, und auch schon Grau. Nach drei Tagen wurden die Stoppeln weich und kratzten nicht mehr.
Morgens wuschen wir uns mit dem Tau, der sich während der Nacht im Windsegel gefangen hatte. Aber wir mochten auch die Salzspuren auf unseren Körpern und leckten uns genüsslich an den empfindungsreichsten Körperstellen.
Wir fuhren zum Fischfang aus, wenn uns danach war und wenn wir unsere Vorräte ergänzen mussten, die wir, in Blätter gewickelt, im feuchten Sand eingegraben lagerten.
Unsere Kraft wurde überschäumend. Wir rannten wie Füllen um unsere Insel, planschten, tauchten und rangen miteinander, was unweigerlich dazu führte, daß wir uns dann liebten. Unsere Sinne wurden so hellwach, stark, sehnsüchtig und lüstern, daß wir schon beim kürzesten Blick auf unsere braunen, biegsamen Körper verführt wurden.
Nach unserer Rückkehr erwartete mich eine schlechte Nachricht. Mein alter Lehrer hatte einen Schlaganfall erlitten und war nun halbseitig gelähmt ans Bett gebunden. Ich besuchte ihn häufig und brachte ihm dann jedes Mal neue Bücher in englischer Sprache aus dem D. K.-Buchladen mit.
Dann teilte mir Benjamin mit, dass er ungefähr drei Wochen lang in verschiedene Landesteile reisen müsse, um Projekte zu besuchen. Er wirkte seltsam entrückt an diesem Abend, fast unfähig zu sprechen, den Blick wie abwesend. In der Nacht presste er sich schweiß-nass an mich, schien mich festhalten zu wollen und schlief sehr unruhig. Nach seiner Abreise fühlte ich mich wie in leerem Raum, aber umgeben von geisterhaften Ahnungen. Ich entschloss mich, etwas Handfestes zu unternehmen, um mich dem unsicheren Gefühl zu entwinden. Ich ging zur Bank, um meiner Familie 20.000 Baht zu überweisen. Dann holte ich die Kontoauszüge ab, die ich bei der Rückfahrt durchzublättern begann. Ich muss wohl fahl im Gesicht geworden sein, denn der Taxichauffeur erkundigte sich besorgt, ob er langsamer fahren solle.
Auf mein Konto war eine Summe von 120.000 Baht überwiesen worden. Eine Abschlusszahlung, in Sorge um meine Zukunft. Der Zeitkontrakt war beendet.
Ich brauchte noch letzte Gewissheit. Noch nie hatte ich in Benjamins persönlichen Unterlagen gestöbert. Jetzt öffnete ich seine mittlere Schreibtischschublade. Ich sah einen blaugelben Flugschein, Bangkok-Frankfurt mit Anschluss nach Stuttgart. Das Datum des Abfluges interessierte mich schon nicht mehr. Daneben ein Foto, datiert vor zehn Tagen und mit der Aufschrift: »Wir freuen uns so auf dich!« Das Bild zeigte eine Frau mit zwei hübschen blonden Kindern. Die Gesichtszüge der Frau waren anziehend, wenn auch etwas herb; sie schien älter als Benjamin.
Dieses Bild war mein Fallschirm. Vielleicht wäre ich sonst auf dem Boden der Wirklichkeit zerschellt. Das Familienfoto zeigte mir zwar deutlich alles, was ich nicht besaß. Aber es gab mir auch das Gefühl, verantwortungsvoll und großmütig zu sein. Denn ich hätte diese Idylle gefährden können, ich, die Hure. Und so schwankte ich nun zwischen dem Selbstgefühl erotisch-magischer Kraft und dem getrosten Gedanken, noch viel Zeit und Möglichkeiten vor mir zu haben, um für mich selbst die Sehnsucht nach Dauer und Verlaß in der Liebe stillen zu können – sofern ich dies wollte.
Eine melancholische Stimmung blieb, aber ich handelte nun in vernunftbestimmter technischer Abfolge. Fast schien mir, als hätte ich diese Abfolge in inneren Planspielen schon mehrfach geübt…..“ (9)
Guadeloupe
„…Alle diese zerzausten farbigen Frauen auf der Suche nach dem Weißen warten. Und gewiss werden sie eines Tages merken, dass sie nicht umkehren wollen, sie werden »an eine wunderbare Nacht, einen wunderbaren Liebhaber, einen „Weißen“ denken. Auch sie werden vielleicht eines Tages gewahr, „dass die Weißen eine schwarze Frau nicht heiraten“. Aber dieses Risiko wollen sie eingehen: was sie brauchen, ist Weiße um jeden Preis.“ (10)
Kolumbien
„… Flora (die einzige Frau in der abgelegenen Gegend, die im öffentlichen Dienst als Dorflehrerin tätig war) machte sich gleich an ihn heran. Sie wartete gespannt vor Garcias Laden, bis Lobo die Reisetasche hineingeschleppt hatte und sie den Gringo sich mit seinen Sachen beschäftigen hörte. Aber erst, als er aus seiner Schlafkammer um Essen rief, war sie sicher, dass er bleiben würde, und wagte es, ihren Posten zu verlassen. Sie rannte zu ihrer Hütte am Dorfrand, keuchend, als würde sie verfolgt, jedoch mit strahlenden Augen.
Eine Stunde später war sie zurück, frisch gebadet und besprenkelt mit Rosenwasser, in einem selbst gemachten Kleid, das zwar im Schnitt keuscher war als im Dorf üblich, aber genau so eng.
Forster stand mit einer Zigarre im Mund an den Ausschank gelehnt, begafft von einigen Männern des Dorfes, die ebenfalls Zigarren rauchten. Er grinste, als er Flora in ihrem schönen rosa Kleid kommen sah, schlenderte aus dem Laden, grüßte sie mit einem unschuldigen Lächeln und ging ein paar Meter mit ihr zusammen – gerade lang genug, um zu fragen, wo sie wohne. Er kam schon in der ersten Nacht….
Tagelang blieb Forster jede Minute an ihrer Seite, sich kaum bewußt, wer und wo er war; er hatte es in seinem Leben noch nicht so gut gehabt. Flora strahlte vor Glück, daß Gott ihr diesen Mann geschickt hatte und prahlte mit ihm im Dorf…
Die Männer von Lobito ließen sich abfällig über Floras unverschämte Hingabe aus. Sie hatte sie alle abgewiesen, diesem Bastardweib waren sie alle nicht gut genug gewesen, aber mit dem Gringo lag sie Tag und Nacht… Die Männer schmollten und tranken, kämpften eine Runde und suchten Vergessen bei anderen Frauen. Aber sie verziehen ihr nicht. Sie behielten Floras Hütte im Auge und warteten, bis sie an die Reihe kämen; war erst der Blonde fort, würde Flora ihnen gehören….
Enttäuscht sah sie ihren Traumprinzen an. Forster bemerkte ihren traurigen Blick, aber nur oberflächlich. »Ich organisiere schon einen Laster der Pacifico, um dich zurückzubringen«, sagte er schnell, in der Hoffnung, sie damit aufzumuntern. Tief in seinem Inneren drangen andere Antworten an die Oberfläche, die er schwitzend verdrängte. Flora, der jede Hoffnung geschwunden war, sprach nun unverblümt aus, was ihr auf dem Herzen lag: »Heiratest du mich, Larry?« Forster lachte lauter als nötig und der Blick, mit dem sie sein Lachen beantwortete, ließ ihn noch lauter lachen. Wollte er damit die Angst übertönen, die ihm der Schmerz in ihren Augen bereitete?
Am folgenden Tag hatte Forster den Vorfall vergessen. Er war verärgert, daß Flora ihn diese Nacht abgewiesen hatte. Sie hätte ihre Tage, sagte sie. Keinen Augenblick hatte er daran gedacht, dass sie lügen könnte. Im Schatten der Hütte trank er Kaffee und träumte von schlammverschmierten Frauenkörpern…..“ (11)
Ehefrust
In Deutschland war Brigitte Lehrerin. Jetzt ist sie „nur noch“ MAP („mitausreisende Partnerin“) und Mutter. Sebastian, ihr Mann, mit dem sie Jahrzehnte zusammen war, hat einen spannenden Job, sie zwei Kinder und ein Häuschen mit Pool und Garten im Ghetto. In ihrer Beobachtung schien er afrikanische Frauen förmlich mit den Augen zu verschlingen. Im Vergleich zu den Diskoschönheiten, die ihren Mann offenbar zunehmend begeisterten, empfand sie sich plötzlich wabbelig, übersät mit Zellulitis und Schwangerschaftsstreifen. Sie versuchte mit Hungerkuren, hübschen Klamotten und Spielchen ihr und sein Sexualleben aufzupeppen. Er schien jedoch immer weniger an Erotik interessiert zu sein, zumindest bei ihr. War es wegen zu viel spannender Arbeit oder wegen einer aufkeimenden Sehnsucht nach anderen Frauen? Er verbrachte zunehmend mehr Nächte am Computer oder trieb sich auf Staubpisten in irgendwelchen Dörfern herum. Die anderen mitausgereisten Frauen in ihrer Umgebung langweilten sie mit ihrer farblosen Oberflächlichkeit, ihre Kontakte zu Einheimischen beschränkten sich auf Nachtwächter, Gärtner, Kindermädchen und ein paar Lieferantenfrauen, mit denen sie auch nicht weit über Small talk hinaus kam. Die Kollegen ihres Mannes empfand sie auch nicht besonders aufregend, meistens war sie nur Zuhörerin bei projekt- oder institutionsinternem Gerede.
Ein paar Monate später flog sie mit den Kindern einige Wochen nach Deutschland und hoffte, die stickige Beziehung würde durch ein bisschen Distanz neuen Wind bekommen. Beim Wiedersehen am Flughafen war er freundlich, verbindlich. Der banale Händedruck bei der Begrüßung ließ auf ein geringes Bedürfnis nach Körperlichkeit schließen, dafür war es neu, dass er bei solchen Gelegenheiten nach Whiskey roch. An einem Abend als sie mit Freunden ziemlich viel guten Rotwein vertilgt hatten, schien seine Lust auf sie aufzuflackern, als er im Bett zu ihr herüberkrabbelte. Da im Land HIV recht häufig vorkam, machte sie sich ihre Gedanken und schlug vor, ein Kondom zu benutzen. Er wies das Ansinnen in einer Art zurück, die jede Lust in ihr absterben ließ, und ihren Verdacht, er gehe fremd, bestätigte. Sie begann über einen Abgang nachzudenken und besorgte sich Infos über den schulischen Wiedereinstieg der Kinder in Deutschland.
Deutschland
„… Und dieses kleine Wiederholungsstück spielen wir nun schon seit Jahren jeden Abend: „Du schönes Mädchen«, sage ich. „Du schöne Mami.“ „Schlaf gut.“ „Schlaf gut.“ „Bis morgen früh.“ „Bis morgen früh.“ „…Träum was Schönes.“ „Träum was Schönes“ „Ich hab dich lieb.“ „Ich hab dich lieb.“ „Gute Nacht. „Gute Nacht.“ Ich küsse MC auf die Wange. Sie lässt ihren Hund los, hebt die Arme und drückt mich fest. „Ich hab dich lieb, Mami“, sagt sie.
In dieser Nacht liegen Thomas und ich, nur wenige Zentimeter voneinander getrennt, die Gesichter einander zugewandt, auf der feuchten Matratze, die uns als Bett dient. Es ist gerade so hell, dass ich sein Gesicht ausmachen kann. Sein Haar ist ihm in die Stirn gefallen, und seine Augen scheinen ausdruckslos – dunkle Seen. Ich habe ein Nachthemd an, ein weißes Nachthemd mit rosa-farbene Baumwollpaspel. Thomas trägt noch das blaue Hemd mit den feinen gelben Streifen und seine Unterhose.
Er hebt die Hand und zeichnet mit dem Finger die Kontur meines Mundes nach. Er streicht mir mit dem Handrücken über die Schulten. Ich rücke ein wenig an ihn heran. Er legt seinen Arm um meine Taille.
Wir haben jetzt eine bestimmte Art zu lieben, unsere eigene Sprache, diese Bewegung, dann jene, langgeübte Signale mit gelegentlichen leichten Abweichungen. Seine Hand, die über meinen Oberstenkel gleitet; meine Hand, die zwischen seine Beine hinuntertastet; eine kleine Bewegung von ihm, um sich frei zu machen, meine Hand seinem Hemd. In dieser Nacht legt er sich über so dass mein Gesicht leicht eingeklemmt wird zwischen seinem Arm und seiner Brust.
Ich erstarre. Schwach, aber unverkennbar hängt da ein fremder Geruch im Stoff seines Hemds. Nicht von Seeluft oder Hummer oder einem schwitzenden Kind.
Der Austausch einer Botschaft zwischen zwei Menschen, die tausendmal, zweitausendmal miteinander geschlafen haben, braucht nur Sekunden. Er wälzt sich von mir weg und bleibt auf dem Rücken, die Augen zur Decke gerichtet. Ich kann nicht sprechen. Langsam ziehe ich Luft ein und sie wieder heraus. Nach einer Weile bemerke ich die kleinen zuckenden Regungen an Thomas Körper – ein Arm, ein Knie -, die mir verraten, daß er eingeschlafen ist…“ (12)
Unterdrückte Sexualität
Tobias ist schwul. Aus beruflichen Gründen und aus ein wenig Abenteuerlust entscheidet sich, als Experte in ein afrikanisches Land zu gehen. Ihm ist wohl bewusst, dass Homosexualität in seinem Gastland noch nach viktorianischem Strafrecht als „widernatürlich“ mit mehreren Jahren Gefängnis bestraft wird. Der Präsident des künftigen Gastlandes hatte noch vor kurzem in einer Fernsehansprache Homosexualität als westliche Dekadenz gegeißelt. Dennoch weiß er, dass es auch dort in den großen Städten eine kleine inoffizielle Szene gibt, vor allem dort, wo auch öfter Touristen anzutreffen sind. Er traut sich zu, sich mit der Situation für zwei Jahre schon arrangieren zu können
Ein halbes Jahr geht es ihm in seinem Gastland relativ gut, wobei er von dem alltäglichen körperlichen Kontakt unter Männern zum Teil sehr verwirrt ist. Die im Land übliche, intensive Körperlichkeit in Alltagsbegegnungen ist für ihn sehr wohltuend im Vergleich zu der reduzierten und distanzierten Art, wie in Europa Männer miteinander umgehen. Jedoch wird im Laufe der Zeit für die Umgebung augenfällig, daß er weder gelegentliche noch langfristige Beziehungen zu Frauen sucht. Er wurde schon manchmal darauf angesprochen und hat als Erklärung immer eine Freundin aus Deutschland vorgeschoben.
Seit einigen Wochen fühlt er sich von einem Arbeitskollegen provoziert. Die Intensität von dessen Berührungen weckt in ihm eine Fülle von Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten. Will sein Kollege ihn anmachen oder interpretiert er viel zu viel hinein? Geht es nur darum, auszutesten, wer der „richtige Mann“ ist, oder ist die Annäherung ernst gemeint? Was passiert, wenn er sich zu erkennen gibt? Wird er dann erpressbar? Steht dann seine Arbeit auf dem Spiel? Er weiß nicht, wie lange er diese zwiespältige Situation noch durchhalten kann. Er ist nahe daran, seine Arbeit aufzugeben. Mit wem kann er reden? Er versucht sein Problem in Worte zu fassen und schreibt an einen Freund in Amsterdam, der allerdings damals seinem Entschluss ins Ausland zu gehen kritisch gegenüber stand und der Afrika weder kennt noch verstehen kann.
Männerliebe
„… Wieviel Spielraum lässt die afrikanische Tradition für die Männerliebe? Burkina Faso, das früher Obervolta hieß. ist eine junge afrikanische Demokratie…Über Homosexualität wird von offizieller Seite nicht gesprochen. Es gibt kein Gesetz. das die gleichgeschlechtliche Liebe verbietet, das heißt aber nicht, dass sie erlaubt oder gar akzeptiert ist. Die Burkinabé neigen dazu, sich im Zweifel eher an die Tradition als an das Gesetz zu halten, und die Tradition kennt keine Homosexualität. Verbot oder nicht: Homosexualität ist präsent. Doch wird sie vor allem mit Europäern und Prostitution in Verbindung gebracht. Ein Coming-out ist kaum möglich: Wird die Familie dich nicht ausstoßen, wird man dich nicht für verrückt erklären. Werden deine Freunde zu dir halten? Bernard Compaore, Gärtner und früherer Empfangschef eines Hotels, wo er für europäische Hotelgäste Knaben organisierte, meint, die Schwulen in Burkina Faso hätten ein eigenes Interesse daran, sich zu verstecken:
,,Wenn einige Schwule sich bekennen würden, wäre Ouaga innerhalb von kurzer Zeit voller Schwuler, die möglicherweise sogar eine Gewerkschaft gründen. Das könnte zur Folge haben. dass die Regierung Homosexualität gesetzlich verbietet“
….Für Jérôme sind Homosexualität und Prostitution Synonyme. Fast zehn Jahre hat er seinen Körper verkauft. Zuerst bot sich der Junge…Europäern an, später baute er sich einen festen Kundenkreis aus einigen reichen Burkinabé auf. Jetzt studiert er Philosophie und möchte aus dem .Männerumfeld ausbrechen. Ich rede mit ihm in einer vollen Bar in der Hauptstadt: ,,Ich komme aus einer streng christlichen Dorffamilie. Mit zwölf kam ich nach Ouaga. wo ich die ersten drei Jahre in einem Jungeninternat gewohnt habe. Danach haben meine Eltern eine komplett möblierte Wohnung mit Fernseher für mich gemietet. Ich habe immer viel Geld gehabt.“ Jérôme ist männlich und muskulös, wie er selbst sagt: ein teurer Typ. Auf dem linken Arm sind Wundspuren sichtbar. Narben von Drogen-experimenten mit halluzinogenen Kräutern. Nie hat er umsonst mit einem Mann geschlafen, abgesehen von Gruppensex mit seinen Freunden, aber dies sei kein Sex, sondern Spaß gewesen…. „In meiner Jugend habe ich das Geld sehr geliebt. Ich ging jeden Abend mit meinen Freunden in teure Läden. wo wir rauchten, viel tranken und Drogen nahmen. Ich ging einen Schritt weiter, indem ich Homosexualität praktizierte. Ich macht das weil ich schockieren wollte, und außerdem brachte es viel Geld. Meinen ersten Kontakt hat ich als Sechszehnjähriger mit einem Franzosen….Ich hatte mit meiner christlichen Erziehung Gewissensbisse und mit Normen der afrikanischen Gesellschaft gebrochen. Doch ich hatte soviel Geld bekommen, daß ich zwei Wochen lang meine Freunde einladen konnte.
Paul hat seit einem Jahr eine Beziehung mit einem niederländischen Entwicklungshelfer… Er sagt, es sei eine Liebesbeziehung, aber Sex bedeute ihm nicht viel…. Für mich zählt nur Zärtlichkeit… Ich bin bisexuell, aber könnte mich in einen Schwulen verwandeln…W enn du Geld hast, respektiert man dich. Wenn du keins hast, mußt du dich verstecken, um kein Opfer der Gesellschaft zu werden… “ (13)

Über Sexualität miteinander reden!
Die Geschichten zeigen keine gemeinsamen Lösungsmuster auf. Das mag enttäuschen, aber auch ermutigen, einen eigenen selbstbestimmten Weg zum Umgang mit dieser sensiblen Thematik zu finden. Jeder Text zeigt nur eine winzig kleine Facette aus unzähligen Varianten der Sexualität in anderen kulturellen Kontextsituationen. Und dennoch tragen die Geschichtchen etwas Verbindendes in sich. Jeder handelnden Person würde die Suche nach Lösungen leichter fallen, wenn sie sich einer anderen Person gegenüber öffnen könnte; wenn es jemanden gäbe, der oder die emotional verstehen und zuhören könnte, ohne zu werten und ohne zu urteilen. Der Schlüssel zum Umgang mit Sexualität und zur Vermeidung von sexuellen Risiken ist Offenheit, vor allem sich selbst gegenüber, und das Schaffen von Vertrauen, d.h. einer Atmosphäre, in der Offenheit überhaupt erst möglich ist.
Die folgenden Buchauszüge beschreiben, quasi als Ausgleich für all die geschilderten negativen und riskanten Aspekte der Sexualität, zwei tropische Augenblicke, in denen Erotik und Sexualität mit einer Stärkung der weiblichen und der männlichen Persönlichkeiten verbunden ist. Was in der Menschheitsgeschichte häufiger mit Sexualität verbunden ist, Glück und Selbstverwirklichung in Partnerschaften oder Leid, Kränkung und Erniedrigung, vermögen wir nicht zu sagen. Wir können jedoch im Privaten und im Projektbezug versuchen, die Chancen für beglückende Aspekte zu erhöhen und die Risiken etwas zurückzudrängen.
Guadeloupe
„….wollte er Telumée vom Hügel La Folie oder eine verzweifelnde junge Frau zum Lachen bringen?. Und ich hielt mein Lachen zurück, weil ich keine befriedigende Antwort fand. Die Pause war zu Ende, wir gingen nachdenklich in das Feuer des Zuckerrohrs zurück.
An den folgenden Tagen setzten wir uns in den Schatten desselben Wollbaumes, ich auf den flachen Stein und der Mann ein wenig abseits den Rücken an den glatten Stamm des Baumes gelehnt. Wir aßen genauso schweigend. Und in jenen leuchtenden Tagen trat mir keiner zu nahe, wie es im Zuckerrohr geschieht, denn Amboises Machete war mein Sonnen-schirm. Eines Morgens dann legte der Mann heimlich ein Paket seines Zuckerrohrs zu meinem Schnitterinnentagwerk, und ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Sein Lied stieg an .jenem Morgen so hoch hinauf, dass sich die Aufseher zu Pferde in der Ferne vergewisserten, ob die Waffe unter ihren Satteltaschen bereit lag. Ich aber war fern von alledem, fern von der Sonne, fern von den Stacheln und den Vorarbeitern und fragte mich nur, ob der Mann dieses Zuckerrohrpaket zum Tagwerk von Telumée gelegt hatte oder zum Tagwerk einer verzweifelten Frau oder aber, und das war in meinen Augen das Schlimmste, ob er damit nur das Andenken von Reine Sans Nom würdigen wollte. Und deshalb unterbrach ich später, als wir unter dem Wollbaum saßen, das Schweigen mit den Worten: »Amboise, ich kenne dich, du hast eine stärkere Natur als viele Männer, aber du bist ebenso feige wie alle Männer.«
Amboise schien meine Worte nicht gehört zu haben, er schwieg er wälzte einen Gedanken und betrachtete seine Hände, als wollte er sie zu Zeugen rufen für das, was er sagen würde..
„Telumée“, sprach er plötzlich mit unruhiger Miene, „Telumée, schönes Glück, du bist viel grüner und strahlender, als ein Siguineblatt unter dem Regen, und ich möchte bei dir sein, was sagst du dazu, antworte!“
Ich schaute Amboise lange an und dachte, wenn die Männer schon die Liebe erfunden haben, werden sie eines Tages auch das Leben erfinden; nun werde ich meinen Platz einnehmen, werde diesem Neger helfen, das Leben aus der Tiefe heraufzuziehen, es wieder auf die Erde zu holen. Dennoch antwortete ich ihm kühl, mit langsamer und verhaltener Stimme: »Amboise, ich bin ein einfaches Stück Holz, das schon am Winde gelitten hat. Ich habe vertrocknete Kokosnüsse am Baum hängenbleiben sehen, während alle grünen Kokosnüsse herabfielen. Das Leben ist eine Hammelhälfte, die an einem Ast hängt; alle hoffen, ein Stück Fleisch oder ein Stück Leber abzubekommen: die meisten aber finden nur Knochen.« Und mit äußerster Mühe, fürchtend, ganz die Fassung zu verlieren, und den Rest meiner Würde dahinschwinden zu sehen, fügte ich hinzu: »In Anbetracht all dessen, Amboise nehme ich deinen Vorschlag an.“ (14)
Haiti
„…. La Nina und El Caucho liegen im Bett. Die Nachttischlampe wirft einen ultravioletten Lichtkegel in den Raum. Noch ist nichts geschehen. Sie liegen einfach nur im Bett, artig, fast regungslos, die nackten Körper aneinandergefügt. Der Liebesakt wird sich erst im Augenblick des Lichts vollziehen, spontan, so wie man zum Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Sie wissen es beide und warten gelassen. La Ninia hat ihr Gesicht auf El Cauchos Schulter gelegt. Ihr Mund saugt an einem kleinen Muttermal, das sie am Ansatz des Schlüsselbeins entdeckt hat. Ihr linker Arm unternimmt Streifzüge unter dem Laken, wandert über Rücken und Lenden. Zwischen den Kuppen der drei ersten Finger ihrer rechten Hand hält sie eine kleine sternförmige Narbe, die sich vom Ellbogen ihres Gefährten abhebt….Sie hält diesen winzigen Höcker fest und denkt nach….
Auch El Caucho liegt auf der Seite, er hat seine Hand um ihren Nacken geschlossen. Seine Finger spielen mit der rieselnden Flut ihrer Haare, die im Lampenlicht noch blauer wirken. Der kleine Wasserfall rauscht, flimmert und springt im Licht über die klobigen Fingerglieder. Mit der freien Hand streicht er über die sanft ruhenden Schenkel und die Wölbung ihrer Hüfte. Regungslos, zufrieden, glücklich und frei von drängender Lust liegen ihre Körper aneinander. Sie suchen sich, spüren sich: sie die harte Knospe seiner Brustwarze, er die elastischen Rundungen zweier Brüste gegen seine entspannten Muskeln….Seidig reibt sich ein Bauch an eine Niederung mit unendlich vielfältigen, zierlichen Rundungen. Die Mulde einer Leiste legt sich wie ein Saugnapf über eine andere Leiste…Vier Beine spielen miteinander. Zwanzig Zehen greifen ineinander, lösen sich wieder; zwei von ihnen gleiten über die Sohle eines Fußes, wandern zur Fessel hinauf, werden unterwegs von einer Zange festgehalten, die sie fesselt, aber sogleich wieder loslässt … La Nina hat Angst. Angst vor dem, was kommen muß… Und wenn…, und wenn… Aber seltsamerweise erfüllt sie auch eine heitere Ruhe und dämpft ihre Angst….
Sein Zeigefinger legt sich über den kleinen Höcker der Klitoris, ergreift davon Besitz… „Ich.. Ich habe noch niemals, niemals…“ „Pst!“ raunt El Caucho. Seine Hand rührt sich nicht. Sollte diese scheinbar lebendige Schleimhaut in Wirklichkeit tot sein? Was heißt überhaupt leben? Sind nicht Leben und Empfinden dasselbe? Was ist Gefühl, was ist Lust? Was ist der Tod? Im Lauf seines harten und beschwingten Lebens als rebellischer Arbeiter hat El Caucho nicht besonders viel Lust erlebt. Wie könnte er da auf solche Fragen eine Antwort geben? Oh! Wie unvernünftig waren doch die Menschen, als sie den Schleier der Dunkelheit über die anziehendsten Körperteile des edlen Menschenkörpers warfen, über jene Organe der Liebe, die besser als alle anderen das Leben spüren! Unter dem Vorwand, es sei unmora lisch oder pornographisch darüber zu reden, hat man ihnen das Wissen um das Geheimnis der Sinnenlust, die vielleicht der Schlüssel zur ganzen Gefühlswelt des Menschen ist, fast gänzlich vorenthalten….Diese törichte Prüderie ist in einem hohen Maße mitverantwortlich für alle pathologischen Störungen im Liebesleben, für die neuzeitlichen Sexualneurosen und für die abartigen Neigungen der Invertierten. Wo genau verläuft die Scheidelinie zwischen Empfindung und Lust? Ist es denn nicht der menschliche Körper als Ganzes, sind es nicht die lebendige Materie und die Psyche, die miteinander verquickt Reize empfangen, in Schwingung geraten und auf diese Weise die Sinneseindrücke als angenehm oder unangenehm beurteilen…? Als er die Nachricht vom Tode seines Freundes Jesus erhielt, hat er da nicht einen eindeutig körperlichen Schmerz in der Brust und im ganzen Körper verspürt? Sind nicht das Lachen und das Weinen Bekundungen der Lust und der Freude, der Reizung, des Schmerzes und des Leidens, sowohl in körperlicher als auch in seelischer Hinsicht?….Und diese Lust, die den Erhalt der Art sichert und für die Ausgeglichenheit der Psyche sorgt, die hat La Nina noch nie erlebt….La Ninia streicht mit ihren schmalgliedrigen Händen über den muskulösen Körper neben ihr. Sie möchte ihn nicht enttäuschen. Sie möchte auf dieselbe rauhe Art glücklich sein wie er… Wie sanft er ist!… Er traut sich nicht. Er hat Angst. Er hat Angst, ihr weh zu tun… Er braucht keine Angst zu haben. Selbst, wenn sie den höchsten Sinnenrausch nicht erlebt, wird seine Gegenwart ihr genügen. Er soll einfach nur dasein, immer nur dasein….Sie war noch nie so glücklich wie jetzt…..Seine Sanftheit reicht für sie beide… La Ninia streichelt die mächtigen Körperglieder, schmiegt ihre Seite gegen die rauhe Wiese des flaumigen Brustkorbs. La Ninia denkt nach. Dieser Mann könnte ihr gehören…! Wie kann sie ihn nur halten?….
„Rafael! Rafael…! Ich bin verliebt…!“ Es war das erste Mal für sie. Und sie war es die ganze Nacht. In der über Port-au-Prince allmählich weichenden Nacht krähten sich die Hähne die Kehlen heiß. Mühelos könnte sie mit ihm ein Leben lang immer wieder glücklich sein……..“ (15)
Nachwort
Die Beschäftigung mit Sexualität birgt ein Risiko in sich selbst: die Gefahr sich selbst offener und damit angreifbarer darzustellen. Widersprüche zur eigenen gelebten Moral könnten für einen selbst oder gar für andere deutlich werden und Brüche zwischen eigener Rationalität und Handeln könnten sich transparenter darstellen. Wenn dieser Schritt des Zulassens von persönlicher Betroffenheit nicht gewagt wird, wirkt die Beschäftigung mit Sexualität und ihren Risiken im Projektkontext häufig verkrampft und hilflos. Ähnlich wie ein heimlicher Alkoholiker zwar lautstark gegen das Trinken predigen kann, aber in der Regel nur über wenig Überzeugungskraft verfügt. Wenn wir zu der Zerrissenheit unseres eigenen Verhaltens und unseren Unsicherheiten stehen, ohne zwanghaft nur andere überzeugen zu wollen, geht eine weit größere Wirkung von uns aus.
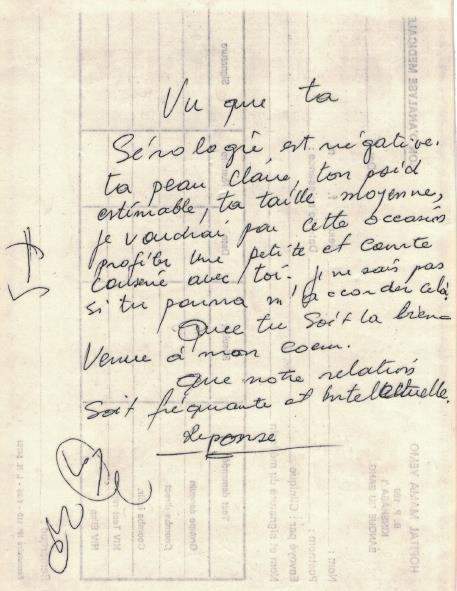
Quellen der Zitate
- Jürgen Wintermeier: ded-brief 4/1981
- Entnommen aus einer nicht-repräsententativen Umfrage unter deutschen Fachkräften in Brasilien, DED, 1993
- Buchi Emecheta: Nuu Ego – Zwanzig Säcke Muschelgeld, Frauenbuchverlag, 1983
- V.Y. Mudimbe: Auch wir sind schmutzige Flüsse, Otto Lembeck, 1976
- Malee: Tigerkralle und Samtpfote, Verlag Simon & Magiera, München, 1984
- Jacques Stephen Alexis: Die Mulattin, Hoffmann und Kampe,1985
- Frantz Fanon: Schwarze Haut, weiße Masken, Syndikat, 1980
- Edith Kresta: „Wenn reisende Frauen vögeln“, taz 8.6.1996, Besprechung der Studie „AIDS, Sex, Tourismus – Ergebnisse einer Befragung deutscher Urlauber und Sextouristen“ von Kleiber, Soellner, Wilke im Auftrag des BMG (Schriftenreihe des BMG Band 33, 1996)
- Malee: Tigerkralle und Samtpfote, Verlag Simon & Magiera, München, 1984
- Frantz Fanon: Schwarze Haut, weiße Masken, Syndikat, 1980
- Peter ten Hoopen: Der Liebeskäfer, Pter Hammer Verlag, Wuppertal 1986
- Anita Shreve: Das Gewicht des Wassers, Piper, 1997
- Liesbeth Weeda: In absoluter Still, taz, 7.6.96
- Simone Schwarz-Bart: Télumée, Peter Hammer Verlag, 1988
- Jacques Stepphen Alexis: Die Mulattin, Hoffmann und Kampe,1985
Frauenärztin in Nicaragua
Barbara Bruns, aus Kontextwechsel, DÜ 1998 (pdf)
Zwei Jahre war ich in Nicaragua als Beraterin und Gynäkologin in einem Frauenzentrum in Masaya, einige Male auch im Landesinneren in einem kleinen Dorf, namens Bocana de Paiwas. Dieser Bericht handelt von Bocana de Paiwas, einem Ort, der Macondo gleicht aus „Hundert Jahre Einsamkeit“ von Garcia Marquez.
Die Tour ging über Matagalpa und San Ramon, Rio Blanco und dann das letzte harte Stück nach Bocana de Paiwas. Die Furten waren schwierig, weil das Wasser wieder angestiegen war – anscheinend regnet es in diesem Eck immer. Aber der Fluß, den man mit dem Jeep nicht durchqueren kann, ist noch nicht erfunden.
Wir kamen nachmittags um halb vier an, Celia, die Leiterin des Frauenhauses, und ich (Aufbruch um sechs Uhr früh). Das Auto wurde wieder unten am Berghang geparkt, die letzten Meter nach oben zu Celias Haus mit den ganzen Kisten Lebensmittel. Celia sorgt immer fürs Essen, weil das Angebot im Ort ziemlich dürftig ist.
Als ich erst mal gebadet und umgezogen war, habe ich den einzigen Schaukelstuhl vors Haus gezerrt und den Blick auf den Fluß genossen.
Esperanza, die Krankenschwester kam dann mit Valentino, ihrem Mann. Ein großes Willkommen und Celia fragte wie üblich „Was gibt es Neues, ist jemand umgebracht worden, den ich kenne?“ (Eine Begrüßung, bei der ich jedesmal schlucken mußte).
Nur zwei Finqueros diesmal, meinte Esperanza. Über den Tod des Einen war Celia richtig froh. „Der Mann hat seine Schwägerin vergewaltigt, als seine Frau krank und außer Haus war“ erzählte sie, „die Schwägerin ist elf Jahre alt.“ Das Mädchen hat den Mund gehalten, bis der Mann anfing, ihre Schwester zu belästigen, eine Achtjährige. Dann hat sie es im Frauenhaus erzählt und die arme Ehefrau hat sich nicht mehr aus dem Haus getraut, um ihre Schwestern zu beschützen. „Das Schwein gehörte zu den Evangelisten und hat sich dreimal die Woche in der Kirche auf die Brust geschlagen und laut gebetet. Ich bin nicht traurig über seinen Tod.“ meinte Celia. Ermordet wurde er nicht wegen dieser Vergewaltigungsgeschichte, sondern weil er was wirklich Schlimmes getan hat. Eine Kuh geklaut oder so was.
Am Donnerstag morgen sind wir nach dem Frühstück ins Frauenzentrum. Es waren wenig Frauen da, nur die, die im Zentrum arbeiten. Die Straßen waren ausgestorben. Esperanza sagte, es hätte leider ein kleines Mißgeschick gegeben, der Typ, der meinen Besuch im Radio angekündigt hätte, hätte den falschen Termin durchgegeben und auch noch zur falschen Zeit. „Dieser Mistkerl“ schimpfte Celia, „ich hab’s ihn extra noch wiederholen lassen“.
Wir saßen also vor dem Frauenhaus und haben gewartet, da kam ein Mann vorbei. Ging erst mal vorbei, kam dann zurück, guckte ein wenig mißtrauisch und verlangte dann „eine Verantwortliche“ zu sprechen. Esperanza hat ihn ins Haus gebeten Celia meinte flüsternd: „Der Richter. Der hat sich hier noch nie hineingetraut.“ Na, ja – was passiert ist, war folgendes:
Gestern abend, der Richter hatte sich schon schlafen gelegt, klopfte es an seiner Tür. Eine Frau aus dem Ort stand davor. Blutüberströmt, das Gesicht zerschlagen, er hatte sie erst gar nicht erkannt. Sie wolle ihren Mann denunzieren, er solle die Polizei verständigen, ihr Mann habe sie zusammengeschlagen. Der Tatbestand war wohl, daß der Mann in der Kantine mit seinen Kumpels trinken war. Das wenige Geld versoffen, was er verdient hatte. Seine Frau hat daraufhin eins der Kinder in die Kantine geschickt, um ihn zu bitten, ihr Geld zu geben, um Essen zu kaufen. Das Kind kam ohne Geld wieder. Daraufhin ist sie selbst gegangen. Die Männer in der Kantine haben sich daraufhin über diesen Ehemann lustig gemacht, „Guck mal, wie seine Frau ihn rumkommandiert, und er läßt sich das auch noch gefallen“. Er konnte das nicht auf sich sitzen lassen und hat sie dann auf offener Straße verprügelt. Alle seine Freunde standen dabei, keiner hat eingegriffen, als er dabei war, seine „Ehre“ zu retten. Der Richter hat dann am nächsten Morgen (!) die Polizei geschickt, da war der Mann schon über alle Berge. „Ihr solltet da auch was tun“, meinte der Richter. „Werden wir auch“, meinte Celia und Esperanza, aber er solle gefälligst seine Pflicht tun, ob er Fotos von der Frau genommen hätte. Nein, hätte er nicht: „Ich bitte Sie, mitten in der Nacht“. Petrona, eine Frau aus dem Frauenhaus ist dann mit der Kamera zu der Frau, die sich in der Nacht noch von dem Arzt im Centro de Salud zusammenflicken hat lassen, und hat sie dann noch zum Richter begleitet, um die Denunzierung offiziell zu machen und zu unterschreiben. Die Frau habe ich gesehen. Sie lief mit einem Handtuch über dem Kopf herum, weil sie sich geschämt hat für ihr blaugeschlagenes Gesicht und ihre gebrochene Nase.
Dann kamen die Patientinnen. Sie kamen an in ihren Stiefeln und Radsporen, die klirrten bei jedem Schritt, legten den Sombrero und die Sporen ab, schälten sich aus ihren Jeans, die sie unter ihrem Kleidchen trugen und verwandelten sich in Damen, die dann über ihre Probleme klagten. Viele hatten keine Consulta nötig, viele hätten durchaus Consulta bei Esperanza machen können, aber mein Titel reizte sie und die Neugier auf diese exotische doctora. Viele erzählten auch einfach aus ihrem Leben, von den vielen Geburten, den lebenden und toten Kindern und den Männern, die in ihrer Zuneigung schwanken wie die Rinderpreise und der Wind.
Diese Frauen aus den Bergen haben einen anderen Wortschatz. Was Schmerz betrifft – alles ist dolor. Ob es ein spitzer, scharfer, stumpfer, konstanter oder immer wiederkehrender Schmerz ist, wird durch die Mimik und Gestik erläutert. „Dolorciiiito“ mit Zusammenkneifen der Augen meist was Stechendes, „Dolooor“ mit zusammengezogenen Brauen eher was Dumpfes. Meist tat es vom Kopf bis zu der Zehe weh, einige hatten Malaria. Fast alle Frauen, die über sechs Kinder zur Welt gebracht hatten, hatten auch Probleme mit Gebärmuttersenkung. Viele wollten einfach nur ein Schwätzchen halten, denn die Tatsache, daß es eine Ärztin gab, die einzig und allein für Frauen da war, war anscheinend was völlig Neues und Faszinierendes in einer Welt, die sonst nur aus Geburt, Arbeit und Tod besteht.
Ich brauchte Esperanza, weil die Frauen oft ganz komisch über ihre Krankheiten geredet haben. Vereistes Blut, böser Blick, verhext waren einige der Sachen, die sie geschildert haben. Esperanza hat mir alles geduldig übersetzt. Vereistes Blut ist niedriger Blutdruck, böser Blick kann Epilepsie sein, oder Kopfweh. Verhext sei meistens Sterilität. Wir haben jeder Frau einen Abstrich gemacht. Noch hat das Frauenhaus Beziehungen zu einem Pathologen im Berta Calderon, der ihnen die Abstriche umsonst macht. Die Frauen müssen nichts zahlen.
Manchmal hatte ich den Verdacht, die Frauen schilderten auch die Symptome von Verwandten und Nachbarinnen, die dann evtl. gleich mitbehandelt werden könnten.
Ich habe mit Esperanza zusammen die Frauen behandelt, und alles zu dem Takt von dreizehn Schreibmaschinen, auf denen im Nebenzimmer die Mädchen des Kurses für Mecanografia stundenlang ausdauernd übten. Sie träumen von einer steilen Karriere als Sekretärin, von einem reichen Boß, der sich in sie verliebt, wie es in den Telenovelas doch immer wieder beschrieben wird. Vielleicht eine Anstellung bei einer der inzwischen 44 politischen Parteien.
Eine Frau kam an, zwei Tage zu Fuß mit hundert ”Cordoba” (20 DM) in der Hand. Sie hat gedacht, ich könne auch eine Sterilisation machen. Konnte ich nicht, sie war ganz enttäuscht. Fünf Kinder hätte sie, 25 Jahre ist sie alt. Jetzt wäre sie schon zum zweitenmal umsonst gekommen. Jetzt ginge sie nicht mehr in die Berge zurück. Wenn sie jetzt ihre Steri nicht kriegen könnte, dann gibt sie das Geld, das sie so lange gespart hat aus und ist nächstes Jahr wieder schwanger. „Schwesterchen, hilf mir“, sagte sie zu Esperanza. Und Esperanza hat alles organisiert, den Transport nach Matagalpa, eine Unterkunft, ein bißchen Geld gesammelt. Und die Frau ist noch am gleichen Tag los nach Matagalpa. „Was es die Frau kostet, das Geld festzuhalten und nicht auszugeben“, meinte Celia. „Das ist ein Vermögen Für die Frauen, wenn es auch der billigste Tarif für eine Steri überhaupt ist“. Eine andere Frau sagte (schwanger, 4 Monate), sie hätte keine Lust mehr, mit ihrem Mann zu schlafen. Er wäre sehr zornig darüber. Nach näherem Nachfragen erzählte sie dann auch, daß er eine andere Frau hätte und sie auch damit öffentlich demütigen würde. „Ich hätte in dem Fall auch keine Lust mehr“ sagte ich ihr, und daß sie sich wehren sollte. „Hab ich auch“ meinte sie. „Ich habe mein größtes Küchenmesser genommen und die andere Frau bedroht. Aber sie hat mich ausgelacht“. Ich habe die Frau Esperanza überlassen – die kann das besser.
Zwischen all den Krankheitsschilderungen kommen dann so nebenbei Tragödien ans Tageslicht, die wie eine Nebensächlichkeit erzählt werden. Eine Frau hatte sechs Kinder geboren. Drei Totgeburten waren dabei. Zwei weitere sind gestorben. „Warum denn?“, habe ich gefragt. Der eine an Masern, der andere ist in eine elektrische Leitung gefallen. „Gab’s denn keine Impfung?“, habe ich gefragt. „Ach, das war 1990, Regierungswechsel, da haben sie uns hier vergessen mit ihren Impfkampagnen“. Celia erzählte, daß in diesem Jahr aus jedem Haus Tag und Nacht das Klopfen der Hämmer zu hören war. Alle Familien mußten Särge machen für ihre Kinder. In aller Eile zurechtgezimmert, die Bretter seien ihnen ausgegangen.
In der Pause bin ich vor dem Haus gesessen und habe auf die Straße geguckt. Die Männer beobachtet, die auf ihren Pferden vorbeigeritten sind. Als sie merkten, daß ich geguckt habe, fingen sie an, ihren Pferden die Sporen zu geben, die Tiere sind gestiegen und wurden dann an der Kandare zurückgerissen. In all dem Treiben ist ein Gockel inmitten von scharrenden Hennen herumstolziert und hat gekräht. Überhaupt kein Unterschied.
Dann kam eine Mutter mit ihrer 12-jährigen schwangeren Tochter in die Klinik. Das Problem war nicht in erster Linie die Schwangerschaft, sondern daß der Typ, der sie geschwängert hatte, nun überall herumerzählt, die Kleine hätte beim ersten Verkehr nicht geblutet, sei daher keine Jungfrau gewesen und er würde sie daher weder heiraten, noch die Verantwortung für irgendwelche Konsequenzen (= Kinder) auf sich nehmen. Die Mutter wollte von mir ein medizinisches Gutachten, daß ihre Tochter sehr wohl Jungfrau gewesen war – damals. Ich sagte ihr, ich würde so ein Ding schreiben, wenn der Junge mir zuerst beweisen würde, daß er auch ”Jungfrau” gewesen war, und ob sie ihrer Tochter nicht mehr glaube als seinem Gerede. Da blickte sie mich an mit dem etwas resignierten Mitleid in ihren Augen für diese blöden Ausländerinnen.
Ich fragte die Kleine (die in der Zwischenzeit auch noch mit einem anderen geschlafen hatte – weil sie jetzt auf dieses neue „Spiel der Erwachsenen“ gekommen war), ob sie den Unterschied zwischen einer Hure und einer ehrbaren Frau kenne. Sie sagte, eine Hure sei eine Frau, die sich mit mehreren Männern einlasse, eine ehrbare Frau „täte es“ nur mit einem. Daraufhin sagte ich ihr, ich hätte in meinem Leben mehrere Liebhaber gehabt. Ob ich in ihren Augen eine Hure sei. „Nein“, meinte sie. „Und warum nicht?“ „Weil du eine Weiße bist.“
Auch rührende Geschichten bekommt man zu hören in der Klinik. So kam eine 38-jährige Frau, die sich behandeln lassen wollte, weil sie nach drei Kindern nicht wieder schwanger wurde. Sie hatte allerdings auch noch einen schweren Herzfehler.
Ich war besorgt und sagte ihr, eine Schwangerschaft sei das Letzte, was ich ihr empfehlen würde, sie habe doch schon drei und solle es gut sein lassen. Eine weitere Schwangerschaft würde sie in ernste Gefahr bringen. Da rief sie ihren Mann herein, fing an zu weinen und erzählte ihre Geschichte.
Die beiden hatten sich im Alter von 15 Jahren kennengelernt und ineinander verliebt. Ihre Eltern erwischten sie, verbaten die Beziehung, der Junge war ihnen nicht gut genug, und zwangen dann die Tochter in eine Ehe mit einem sehr viel älteren und ungeliebten Mann. Sie blieb gehorsam mit diesem Mann verheiratet und gebar ihm drei Kinder. Nach 20 Jahren starb er, und sie traf ihren Jugendfreund wieder. Er war niemals verheiratet gewesen, hatte auf sie gewartet. Nun hatten sie endlich die Möglichkeit, ihre Liebe zu leben. Sie wollte ihm nun den größten Beweis ihrer Liebe schenken – ein Kind, aber es klappte nicht. Der Mann selbst war nicht so versessen auf ein eigenes Kind, aber die Frau erklärte weinend, sie wolle lieber in Liebe sterben, als weiterzuleben, ohne versucht zu haben, ihm diesen Beweis ihrer Liebe zu schenken.
Der nächste Tag verlief wie der vorherige. Esperanza hat die Frauen behandelt, ich habe zugehört, ihr weitergeholfen, wir haben uns gut ergänzt. Die Frau kann viel. Was fehlt, ist ein bißchen Fachwissen, ab und zu ein Trick, ein wenig Selbstbewußtsein. Und dann kommt noch die absolute Titelhörigkeit der Bevölkerung dazu. Eine Frau wollte nur von mir behandelt werden. „Wissen sie, ich vertrau einfach den Amerikanerinnen mehr als den Nicaraguanerinnen“. Ich sagte ihr, daß ich Deutsche sei. „Noch besser“, meinte sie. Ob sie wisse, wo Deutschland liegt, fragte ich. Wußte sie nicht.
Vor dem Frauenhaus spielten wie immer Kinder, meistens Mädchen. Die Älteren über sieben Jahre hatten fast immer ein Baby im Arm, auf das sie den ganzen Tag aufpassen müssen. Diese kleinen Mädchen sind bereits verantwortungsvolle Muttis, sie sitzen mit den Säuglingen auf der Schwelle, schaukeln sie auf ihren Armen, während die männliche Jugend mit Baseballschlägern an ihnen vorbeizieht, um auf einem Platz vor dem Ort für das Nächste Campionato zu üben.
Während wir vor dem Frauenhaus saßen, kamen drei Polizisten vorbei. Der eine zeigte auf das Haus und meinte zu den anderen: „Das ist dieses Haus, wo man den Frauen diese Flausen in den Kopf setzt, es sei eine Sünde, eine Frau zu schlagen.“ Die anderen beiden lachten sich tot und Celia stand auf, um sie zu fragen, was so komisch sei. Kaum sahen sie Celia auf sich zukommen, gaben sie Fersengeld und flitzten davon.
Nachmittags saß ich auf der Schwelle des Frauenzentrums und habe mit den Kindern gespielt. Gloria, die vierjährige Adoptivtochter von Esperanza hat von ihrer Adoption erzählt. „Diese Frau“, sie nennt ihre leibliche Mutter seitdem nur noch so, hätte sie vor einem Jahr Esperanza geschenkt. Esperanza wollte erst nicht, sie hat schon ein Sammelsurium von Adoptivkindern um sich herum. Schließlich, weil „diese Frau“ nicht locker ließ, ist sie mit ihr und dem Mädchen zum Richter, um es amtlich zu machen. „Der Richter“, meinte Gloria, „hat zu dieser Frau gesagt – hören sie, Kinder verschenkt man nicht, Kinder liebt und hütet man. Hunde verschenkt man. Aber diese Frau hat mich verschenkt, wie einen Hund.“ Jetzt allerdings nennt Gloria Esperanza „Mama“ und ist Beschützerin aller Hunde im Ort geworden.
Nach der Arbeit sind wir jeden Tag an den Fluß hinuntergegangen. Wenn man am Ufer steht und den Sonnenuntergang abwartet, dann scheint Bocana de Paiwas der friedlichste Ort der Welt. Die Frauen gehen meist zu Fuß, mit einer Hand schürzen sie ihr Kleid, im Arm haben sie ein Kind. Das Wasser steht so niedrig, daß es jetzt kein Problem mehr ist, hindurchzuwaten. Einige waschen am Fluß ihre Wäsche, andere sich selbst, die Kinder planschen begeistert – die reinste Idylle.
Der Samstag fing schon mal gut an. Eine Frau aus den Bergen, ein zweijähriges Mädchen im Arm kam auf uns zu, als wir gerade ins Frauenhaus gehen wollten. Sie sei mit ihrer Tochter aus den Bergen gekommen. Lange gewandert seien sie. Ihre Tochter läge jetzt in den Wehen, sie wolle im Frauenhaus entbinden bei der „doctora alemana“. Sie könne aber nicht mehr laufen. Celia hat sofort zwei Männer mit einer Hängematte in das Haus geschickt, um die Frau zu holen. Dann sind wir zusammen ins Centro de Salud, wo der Arzt und der Krankenpfleger waren und haben gefragt, ob die Frau im Centro entbinden könnte, im Frauenhaus gibt es kein steriles Zeug. Der Arzt war einverstanden. Sie haben einen winzigen Kreissaal und ein paar Medikamente da. Er war richtig glücklich, weil nur 2 Frauen im Monat bei ihm entbinden von monatlich durchschnittlich 35, die ihre Kinder kriegen. Die Frauen kamen an und meinten gleich, bei einem Mann wollten sie aber nicht entbinden. Der Arzt war einverstanden, daß ich die Geburt mache und hat sein Centro zur Verfügung gestellt. Das war seinerseits eine ziemliche Leistung, diese Zurückhaltung. Und gleichzeitig die ideale Gelegenheit, Freundschaft zu schließen und eine künftige intensivere Zusammenarbeit zu planen.
Das Mädchen in den Wehen war knapp 15, hatte einmal eine Schwangerschaftskontrolle gemacht und nur eine Karte, auf der das Wort „Hochrisikoschwangerschaft“ unterstrichen war. Sie war klein mit einem Riesenbauch und mir ist das Herz in die Hose gesackt bei dem Gedanken, daß das nächste Krankenhaus vier Stunden mit dem Jeep entfernt war. Dann war sie auch extrem schwierig. Nix wollte sie, nicht untersucht werden, sich nicht ausziehen, nicht aufs Bett. Die Mutter immer dabei mit dem zweijährigen Kind auf dem Arm und rumgezetert. „Neun Kinder habe ich geboren. Aber solche Extravaganzen, wie Centro de salud habe ich mir nie geleistet.“ Das Mädchen hat kein Wort gesagt. Die Geburt zog sich über Stunden hin. Es ging nichts weiter, alle waren erschöpft. Als ich erfahren habe, daß sie seit drei Tagen nichts gegessen hatte, habe ich ihr erst mal mit Hilfe des Arztes eine Zuckerlösung angehängt. Der Tropf war ihr ein Horror. „Meine Tochter stirbt, meine Tochter stirbt, sie hat schon einen Tropf“, zeterte die Alte. Und „ich habe dir ja immer gesagt, krieg das Kind Zuhause und stirb in Würde, aber auf mich hört sie ja nicht“. Dann habe ich auch noch ein Wehenmittel spritzen müssen. Es war zum Verzweifeln, nach Matagalpa hätte ich nicht mehr können. Endlich hat das Mädchen zu pressen angefangen. „Im Bett geht das nicht“, sagte die Mutter. Ich völlig entnervt: „Und wo dann bitte schön?“. Da hat die Mutter das Mädchen aus dem Bett runtergezerrt und in die Knie gezwungen. „Nun Tochter, sei kein Feigling“. Ich hatte noch eine Frau aus dem Frauenhaus dabei, die geholfen hat, und das Mädchen hat ihr Kind auf den Knien bekommen. So schnell hatte ich gar nicht die Handschuhe an.
Ein dickes Mädchen wurde auf dem Fußboden geboren. Neun Pfund schwer. Und hat gelebt und geatmet und geschrien. Das Abnabeln war dann leicht und ich so selig, wie schon lange nicht mehr.
Die Alte hat dann das lange Haar ihrer frisch entbundenen Tochter gepackt, zusammengedreht und ihr in den Mund gestopft. Was das denn solle, fragte ich. „Nun wirst Du ein Geheimnis aus den Bergen kennenlernen“, lächelte sie. Und durch das Würgen der Tochter und das unwillkürliche Pressen dabei kam die Nachgeburt ohne Probleme. Ob das die Haare oder das Oxytocin war, daß ich gespritzt hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls gabs keine Blutung, alles in Ordnung, ich habe den Arzt gerufen, der sich um das Kind gekümmert hat, während ich die Mutter untersucht habe. Jetzt Gott sei Dank wieder auf dem Bett. Sie war aufgerissen und wollte sich partout nicht nähen lassen. Die Alte war auch ganz empört. „Lassen sie sie so“, meinte sie. Und ich habe ewig gebraucht, vier Stiche zu machen. Mit Lokalanästhesie, es war echt nicht schlimm. Aber die frischgebackene Mutter hat sich gewehrt gegen diesen „neumodischen Kram“ und mir fast ihren Fuß ins Gesicht getreten. Der noch dazu unheimlich dreckig war. Na ja, ich hab auch keine Dankbarkeit erwartet, ich war viel zu glücklich, um mich darüber aufzuregen. Wie sie denn heißen solle, habe ich gefragt. „Weiß nicht“, meinte die Mutter, „ich werde sie Namenlos nennen“. Ob die Mutter denn ihr erstes Kind auch mit 14 gekriegt hätte. Das wüßte sie nicht. Sie weiß nicht, wie alt sie ist.
Celia hat dann noch Kinderkleidung angeschleppt, die die Frauen zusammengesammelt hatten. Das meiste kam aber aus Celias Kleiderschrank. Die beiden hatten nichts dabei. Die Frauen aus dem Frauenhaus sind wirklich unglaublich im gegenseitigen Helfen, das war beeindruckend.
Manchmal sitze ich hier in Masaya in meinem Patio unter der Bananenpalme und denke über den Sinn des Lebens und meinen Platz in dieser Welt nach.
Recordar, erinnern, kommt aus dem Lateinischen re-cordare – durch das Herz ziehen lassen. Ich lasse also all die Bilder durch mein Herz ziehen und versuche, irgendwo einen roten Faden zu entdecken.
Die Frauen hier sagen mir immer – es sei müßig, über morgen nachzudenken. Morgen kann ein Vulkan ausbrechen, ein Hurrikan kommen, eine Epidemie, der Krieg beginnen, der Tod oder die Liebe können zuschlagen – was hat es für einen Sinn, Pläne zu machen? Wie überaus biblisch – der heutige Tag hat Mühe genug.
Und dann fällt mir das kleine namenlose Mädchen aus den Bergen ein und Gloria, Esperanzas Adoptivtochter, oder die Vollmondnacht, in der Celia Gedichte vorgelesen hat und ich bin plötzlich ganz glücklich und denke mir, es hat doch alles einen Sinn.

